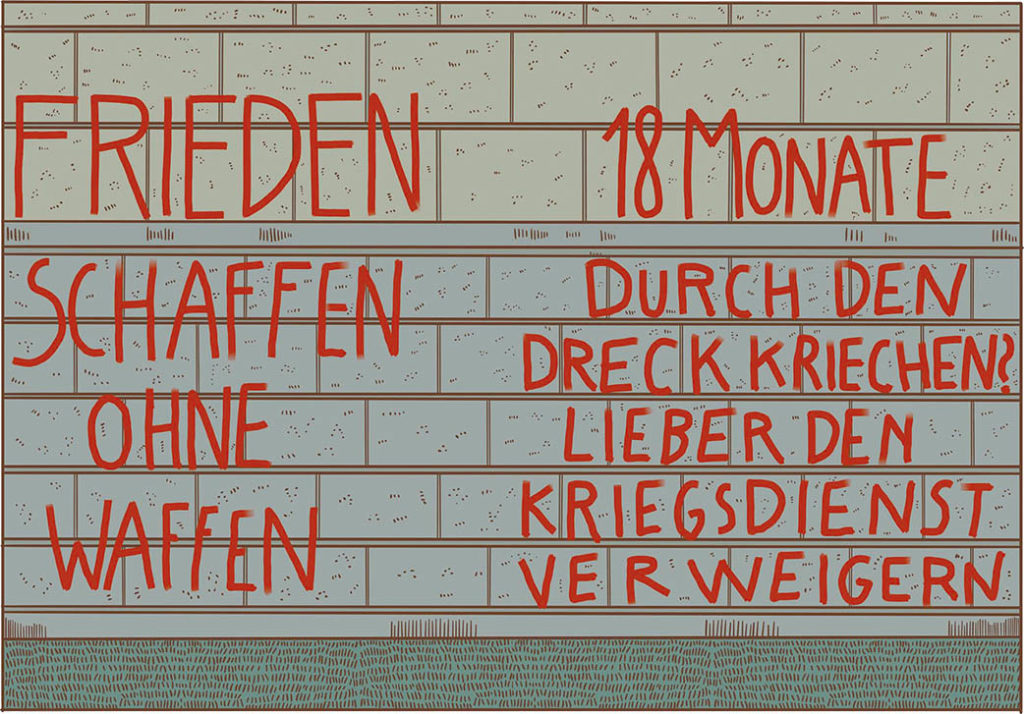| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2021 |
Kriegsdienstverweigerung
European Bureau for Conscientious Objection (Ebco) – Europäisches Büro für KDV
Von Guido Grünewald
„Was macht eigentlich das Ebco?“, fragte unser politischer Geschäftsführer, Michi Schulze von Glaßer, vor einigen Wochen in einem Telefongespräch. Eine kurze Antwort könnte lauten: Ebco leistet mit geringen Ressourcen eine gute, solide Arbeit.
Juristisch eine Körperschaft nach belgischem Recht mit Sitz in Brüssel, was die Erfüllung komplizierter Regularien erfordert, ist Ebco in der Praxis ein Netzwerk von 30 bis 40 Individuen, die größtenteils Mitglied in pazifistischen Organisationen sind und diese teilweise offiziell repräsentieren. Ebco hat kein festes Büro, sondern nur eine Postadresse im Brüsseler Maison de la Paix und keine bezahlten Mitarbeiter:innen; die gesamte Arbeit erfolgt ehrenamtlich mit einem lächerlich geringen Jahresetat von knapp 4 000 Euro.
Jeweils im Frühjahr und Herbst treffen wir persönlich zusammen, ansonsten kommunizieren wir per E-Mail. Nach mehrmaligen coronabedingt digitalen Zusammenkünften konnten wir Anfang Oktober erstmals wieder ein Präsenztreffen in Brüssel abhalten, bei dem allerdings nur ein kleiner Teilnehmer:innenkreis anwesend war; andere Aktive waren digital zugeschaltet. Wir haben unser Zusammentreffen zu einer Unterstützungsaktion für Ruslan Kozaba vor der Mission der Ukraine bei der Europäischen Union genutzt.
Während Ebco-Mitgliedsorganisationen häufiger auf der Straße aktiv werden, erfolgt die Arbeit des Büros selbst hauptsächlich im Hintergrund: Recherche und Erstellung des jährlichen Berichts zur Lage der Kriegsdienstverweigerung (KDV) in Europa; Erklärungen zur Unterstützung einzelner Kriegsdienstverweigerer (KDV-er) oder von KDV-Organisationen sowie Unterstützung von Asylanträgen; Lobbyarbeit im Europäischen Jugendforum, in dem Ebco Mitglied ist, im EU-Parlament, beim Europarat und den Menschenrechtsinstitutionen der Vereinten Nationen.
Dies erfolgt häufig in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Versöhnungsbund (IFOR), der War Resisters‘ International (WRI) und dem Quaker-Büro bei den Vereinten Nationen (QUNO), die alle Mitgliedsorganisationen des Ebco sind; auch mit Amnesty International und Connection e.V. ist die Zusammenarbeit gut. Seit Kurzem hat Ebco außerdem die Befugnis, unter Bezug auf die Europäische Sozialcharta eine Kollektivklage beim Europäischen Ausschuss für Sozialrechte einzureichen. Dies kann eventuell in Bezug auf die Ausgestaltung des Zivildienstes in einzelnen Staaten relevant werden.
Ebco-Aktivitäten im Jahr 2021

Hier einige Ebco-Aktivitäten des laufenden Jahres: internationale Solidaritätserklärung zugunsten israelischer KDVer; diverse Statements und Aktionen zur Unterstützung Ruslan Kozabas; Veröffentlichung des Berichts Conscientious Objection to Military Service in Europe 2020 (https://bit.ly/3CUaVCD); Eingabe beim UN-Menschenrechtsrat gemeinsam mit der Vereinigung griechischer KDV-er anlässlich des Universal Periodic Review zu Griechenland; Erklärung, dass Finnland den Empfehlungen des UN-Menschenrechtsausschusses folgen sollte; Erklärung zur Unterstützung türkischer KDVer am 15. Mai, dem internationalen Tag der KDV; gemeinsame NGO-Erklärung zugunsten des griechischen Verweigerers Charis Vasileou; Erklärung zum Internationalen Friedenstag (21. September), in der auf die Bedeutung der KDV hingewiesen wird.
Im Zentrum der Diskussionen standen im laufenden Jahr die schwierige Situation der KDVer in Griechenland, der Türkei und in der Ukraine. Die ersten beiden Staaten sind leider „Dauerbrenner“, in denen sich nur kleine (Griechenland) oder gar keine Fortschritte abzeichnen. Der Verein für KDV (Vicdani Ret Derneği) in Istanbul hat eine ausführliche Darstellung der schlimmen Lage der KDVer in der Türkei in englischer Sprache veröffentlicht, auch mit einigen Fallbeispielen. Die zusammenfassende Einleitung mit konkreten Empfehlungen an die türkischen Behörden und internationale Menschenrechtsgremien hat Rudi Friedrich von Connection e.V. dankenswerter Weise ins Deutsche übersetzt (https://bit.ly/3kaJbSK; Gesamtstudie in Englisch unter https://bit.ly/3nZfsxr).
In der Ukraine wurde kürzlich neun protestantischen KDVern die Anerkennung verweigert; im Juli wurde ein Gesetz verabschiedet, das einen patriotischen Unterricht für alle Schüler:innen (Alter: 6-18) sowie eine vormilitärische Ausbildung in den beiden letzten Schuljahren (Alter: 16-18) obligatorisch vorschreibt.
Sorgen bereitet auch die Entwicklung in beiden Teilen Zyperns, wo die vor einigen Jahren begonnene Initiative für ein KDV-Gesetz folgenlos verpufft ist und durch die Verknüpfung der Datenbanken von Polizei und Militär nun alle, die ihrer Pflicht zu Reserveübungen nicht nachgekommen sind, leichter identifiziert und festgehalten werden können.
Während in der Schweiz ein Frontalangriff auf den Zivildienst abgewehrt wurde, beendete Finnland die den Zeugen Jehovas bisher zugestandene Befreiung von Militär- und Alternativdienst. Der Alternativdienst weist nach wie vor eine unverhältnismäßige Dauer auf , und es gibt Bestrebungen, ihn in ein Gesamtverteidigungskonzept unter dem Label „umfassende Sicherheit“ zu integrieren.
Kompliziert ist auch die Lage in Russland. Die Organisation „Soldatenmütter“ in St. Petersburg hat die Abteilung, die Informationen über Menschenrechtsverletzungen in der Armee sammelte, geschlossen. Ursache ist eine Liste von 60 Themen, die der Föderale Sicherheitsdienst, der größte inländische Geheimdienst, Ende September veröffentlicht hat. Jede Person und jede Organisation, die diese Themenfelder öffentlich berührt, kann als „ausländischer Agent“ eingestuft werden, was u.a. dazu führt, dass dieses Label auf allen Publikationen erscheinen muss. „Die Zeiten sind in der Tat hart in Russland“, schrieb unsere russische Kontaktperson. Eine internationale Solidaritätserklärung sei nicht hilfreich, im Gegenteil, sie bestätige den russischen Behörden, dass es sich tatsächlich um ausländische Agenten handle. „Das muss von der russischen Bevölkerung beendet werden, und ich hoffe, das geschieht noch zu meinen Lebzeiten.“
Unter der agilen Präsidentin Alexia Tsouni von der Vereinigung griechischer KDVer und von Amnesty International, die seit einem Jahr Friedhelm Schneider abgelöst hat, wendet sich Ebco auf diversen Kanälen stärker an die Außenwelt.
Beispiele sind diverse politische Erklärungen u.a. zum Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags, ein Video mit persönlichen Botschaften (https://bit.ly/3o9zPIu und die aktive Teilnahme am Weltkongress des Internationalen Friedensbüros (https://bit.ly/3qaFobY).
Im Hinblick auf eine Erklärung zum Nakba-Tag, die Alexia Tsouni verfasst hatte und die am 15. Mai ohne vorherige Konsultation veröffentlicht wurde, haben Friedhelm Schneider, die Vertreterin der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) und ich für die DFG-VK Protest eingelegt. Wir haben bemängelt, dass die Erklärung in einer Situation einer aktuellen militärischen Auseinandersetzung keinen Aufruf zur sofortigen Beendigung jeglicher Gewaltanwendung seitens aller Seiten enthielt, einseitig als Unterstützung der Palästinenser (keine Unterscheidung zwischen Zivilbevölkerung, den Regierungen in Palästina und bewaffneten Brigaden) verstanden werden konnte und nicht auf die Perspektive hinwies, dass der Konflikt nur mit diplomatischen und gewaltfreien Mitteln und dem Ende der Besatzung gelöst werden kann. Nach einer langen Diskussion wurde im Digitaltreffen Anfang Juni entschieden, Statements künftig erst nach vorheriger Konsultation in der E-Mail-Gruppe zu verabschieden. Die bereits veröffentlichte Erklärung zum Nakba-Tag wurde auf der Webseite durch eine in unserem Sinne überarbeitete Version ersetzt.
Guido Grünewald ist internationaler Sprecher der DFG-VK, deren Vertreter bei Ebco und dort im Vorstand.