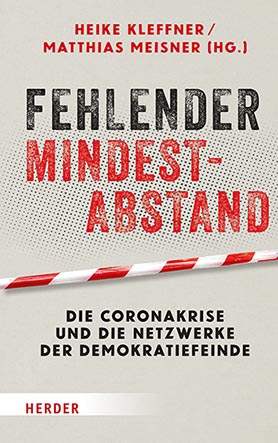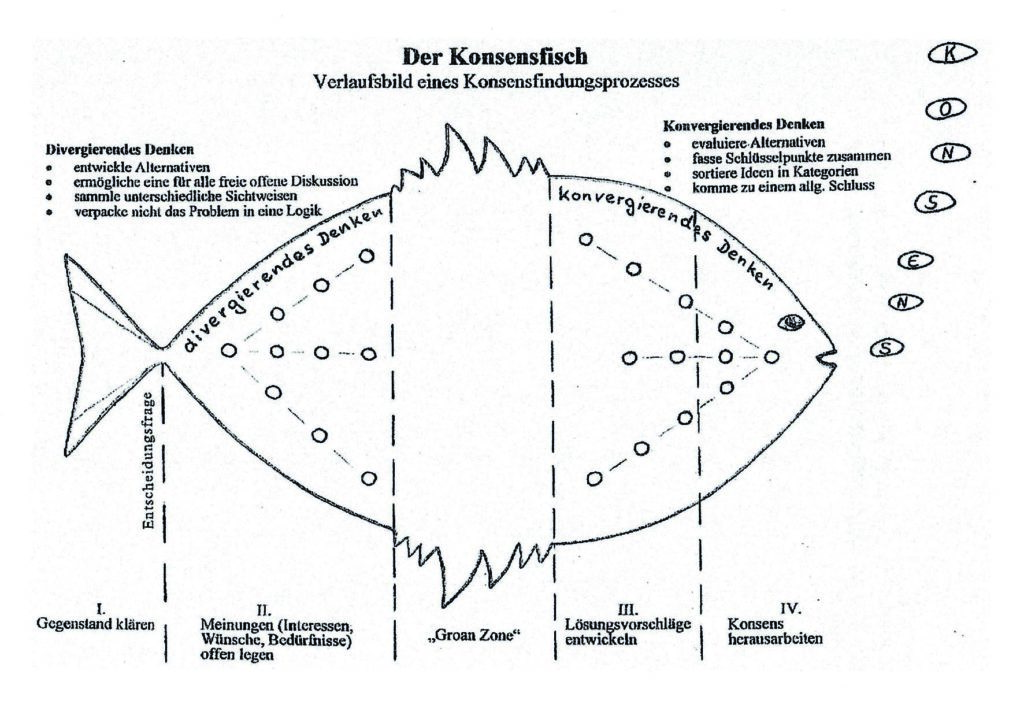| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 4/2021 |
Literatur
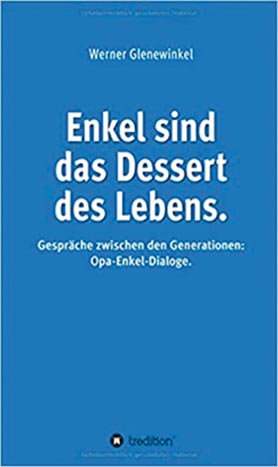
Werner Glenewinkel: Enkel sind das Dessert des Lebens. Gespräche zwischen den Generationen: Opa-Enkel-Dialoge. Hamburg 2021; 240 Seiten; 10,99 Euro (E-Book: 6,90 Euro)
Was macht ein alter Pazifist – alt im Sinne von langjährig und seines Lebensalters? Werner Glenewinkel ist so ein alter Pazifist mit 76 Lebensjahren und einigen Jahrzehnten DFG-VK-Mitgliedschaft. Dank seiner Zugehörigkeit zu einer Patchwork-Familie ist er Großvater von fünf Enkelkindern – und schreibt darüber ein Buch. Eigentlich ein Gesprächsbuch.
Denn er nimmt seine Enkelkinder und ihre Fragen ernst. Und das Buch enthält deshalb überwiegend „Opa-Enkel-Dialoge“.
Der promovierte Jurist Werner Glenewinkel war Asta-Vorsitzender, Zeitsoldat, staatlich nicht anerkannter Kriegsdienstverweigerer, Dozent an einer Fachhochschule, Familientherapeut, Vorsitzender der Zentralstelle KDV … ein reiches Leben mit großem Erfahrungsschatz und vielen Einsichten des kritischen Zeitgenossen fächert sich da auf.
Krieg und Frieden sowie Demokratie und Gerechtigkeit sind die beiden großen Themenbereiche und Interessen im Leben des Großvaters. Und so tauchen diese in vielen der Dialoge mit den Enkeln auf. Die Kinder fragen, er erklärt Zusammenhänge, beschreibt, was er erlebt hat und wie der das bewertet. Damit sind die Gespräche auch ein Stück Geschichtsunterricht, aber eben nicht im Sinne der Vermittlung theoretischer oder sachlicher Inhalte. Sondern entwickelt aus der persönlichen Erfahrung und so, dass die Enkel viel fragen und verstehen können.
Ein Beispiel für den Stil der Dialoge, hier zum Thema Bundeswehr und Kriegsdienstverweigerung:
(…) Was wäre gewesen, wenn du dich geweigert hättest – wegen „Nie wieder Krieg!“? Ich hätte den Kriegsdienst mit der Waffe veweigern können. Das war ja im Grundgesetz in Artikel 4 Absatz 3 ausdrücklich vorgesehen. Warum hast du das nicht gemacht? Meine Eltern haben mir die Entscheiung überlassen. Ja, leider. Nachdenkliche Pause. Obwohl die den Krieg erlebt hatten? Ja, und ich hatte keinen Lehrer, der mich angeregt hätte, darüber genauer nachzudenken. Und deine Klassenkameraden? Einige mussten nicht zur Bundeswehr. Verweigert hat keiner. Die Enkelkinder drängen sich aufgeregt um den Opa. Opa, muss ich auch zur Bundeswehr? (…)
Und warum „Dessert des Lebens“? Ein schönes Sprachbild. Es beinhaltet auch, das nach der „Mühe der Erziehungsarbeit“ mit den eigenen Kindern nun eine schöne und leichte Lebensphase folgt. Wie der krönende und genussvolle Abschluss einer guten Mahlzeit. Zu wünschen wäre Werner Glenewinkel – und auch den Enkeln –, dass ihm noch viel Zeit bleibt für den fruchtbaren Austausch mit der neuen Generation.
Und vielleicht kann die Lektüre des Buches andere „alte PazifistInnen“ anregen, seinem Beispiel auf je ihre Weise zu folgen.
Stefan Philipp