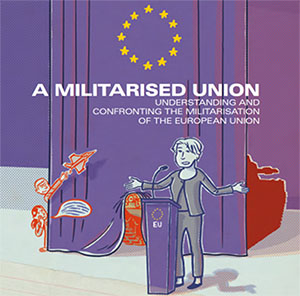| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2021 |
DFG-VK-Info
DFG-VK-U35-Treffen in Kassel
Von Michael Schulze von Glaßer

Vom 17. bis 19. September fand im nordhessischen Kassel das sechste Treffen der jungen DFG-VK-Mitglieder unter 35 Jahren statt. Zwar hat unser Verband aktuell knapp 3 600 Mitglieder, der „U35“-Anteil liegt aber nur bei rund 225 Personen. Die DFG-VK fördert die Jugendarbeit daher seit Jahren und organisiert etwa regelmäßig bundesweite Treffen.
Aufgrund der Coronapandemie konnte das diesmal aber nur in „abgespeckter“ Form stattfinden – zehn junge Leute waren in Kassel dabei. Doch auch in diesem kleinen Kreis wurde viel gemacht und diskutiert: Es gab einen Input zu „Lobbying von unten“, in dem anhand von Beispielen gezeigt wurde, wie man auf Politiker*innen und andere Entscheidungsträger*innen Einfluss nehmen und sie von unseren friedenspolitischen Positionen überzeugen kann.
Ein junges Mitglied mit kolumbianischen Wurzeln erklärte uns den aktuellen Konflikt in dem südamerikanischen Land: Viele Menschen dort fordern gerade mit Protesten soziale Verbesserungen und werden von der Regierung mit Milizen und dem Militär niedergeschlagen – dabei kommen auch Waffen aus Deutschland zum Einsatz.
Darüber hinaus wurde auf dem U35-Treffen auch viel über die DFG-VK – etwa die Strukturen des Verbands – diskutiert. Es war ein „kleines aber feines“ Treffen in Kassel. Im kommenden Jahr soll es – nach hoffentlich weitestgehend überstandener Pandemie – wieder ein größeres Treffen geben.
Michael Schulze von Glaßer ist politischer Geschäftsführer der DFG-VK.