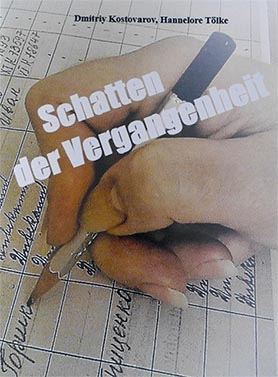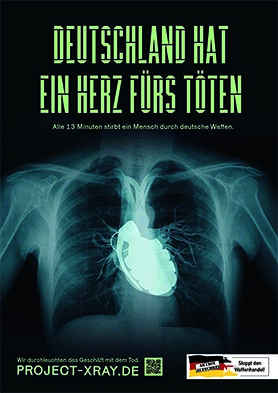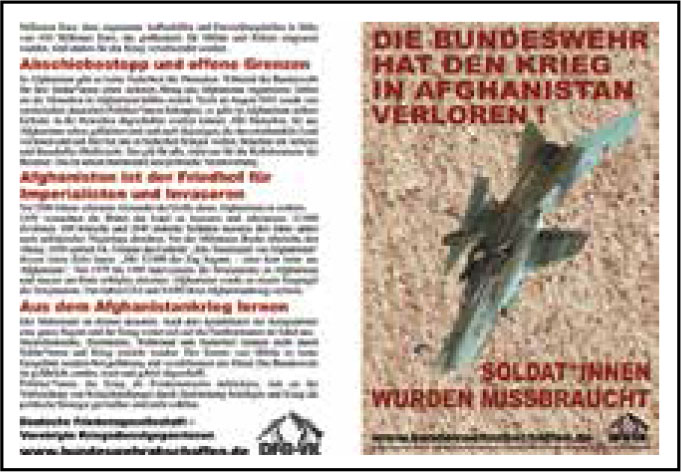| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2021 |
Antimilitarismus
Kein Heldengedenken mehr in der Kasseler Karlsaue
Von einigen Aktiven aus der Antimilitaristischen Aktion Berlin (amab)

Nach einer Plakat-Aktion am kriegsverherrlichenden und Nazi-Mörder ehrenden „Ehrenmal“ an der Kasseler Karlsaue sind die dortigen Reservist*innen stinksauer. Denn die Parkverwaltung sagte daraufhin die jährlich stattfindende Feier zum Volkstrauertag ab. Begründung: Die Gefallenen seien „Täter und Opfer“.
Das Hass-Denkmal in der Karlsaue
Im September eröffnete die Stadt Kassel im Schlosspark in der Karlsaue nach langer Restaurierung feierlich das Ehrenmal. In den drei Stockwerken des Ehrenmals gedenken gleich mehrere Tafeln und große Reliefs der faschistischen Mörderbanden. Die völkischen Gedenktafeln für die im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten bedienen in einigen Fällen auch noch die Dolchstoßlegende. In der obersten Etage stellt sich die Bundeswehr mit einer eigenen Plakette in diese deutsche Tradition. (https://bit.ly/3DBjh1K)
Kein Wort zur Shoa. Außerdem gibt es auf dem Ehrenmal eine besondere weitere Tafel für Deserteur*innen des Zweiten Weltkriegs. Erklärende Schilder an den Eingängen weisen darauf hin, dass das Denkmal „kontrovers“ sei, und verbreiten die blanke Lüge, dass es für Frieden werbe. Von den Millionen von deutschen Soldaten getöteten Menschen findet sich kein Wort. Auch die Shoa, die ohne den Vernichtungskrieg der deutschen Soldaten nicht denkbar wäre, findet mit keinem Wort Erwähnung.
Sachbeschädigung

Zuletzt in den Medien war das Denkmal im September. Fiese Chaot*innen hatten das „Ehrenmal“ eines Nachts ganz schlimm entweiht. Die Chaot*innen kleisterten das Denkmal mit an Tabak-Warnhinweise erinnernde Poster voll. Diese informierten „Soldat*innen sind Mörder*innen“ und „Nationalismus gefährdet Ihre Gesundheit“. Die unerkannt gebliebenen Chaot*innen („Rheinmetall entwaffnen“ solidarisierte sich auf Instagram, bestritt aber eine Urheber*innenschaft) kritisierten, dass die Kasseler Stadtgesellschaft das Hetz- und Hassdenkmal bis heute duldet und schönredet. (https://bit.ly/
3lIpp1R)
Kreative Veränderungen
Mit einigen der als Gefallenen-Gedenken verharmlosten Hass-und Hetzslogans am Denkmal setzten sich die unerkannt gebliebenen Chaot*innen intensiver auseinander. Eine Tafel mit dem Slogan „Die Toten verpflichten die Lebenden“ ergänzten sie mittels Aufklebern um die Worte „zu Antifaschismus und Antimilitarismus.“ Das Zeichen der eigentlich gemeinten uniformierten Mörderbande überklebten sie mit einer Abbildung. Diese zeigt zwei Hände, die – so wie im DFG-VK-Logo – ein Gewehr zerbrechen. Auch die Tafel für die Bundeswehr fand ein besonderes Interesse bei den Chaot*innen. Diese ergänzten sie mit dem Slogan „Nazidenkmal? Hier pass ich hin!“
Volkstrauer-Feier abgesagt
Anlässlich des Volkstrauertags berichteten nun die Hessischen Neuesten Nachrichten (HNA), dass der Chef des Reservist*innenverbands in Kassel stinksauer sei. Er sei aus „allen Wolken gefallen“, als er noch im September erfuhr, dass die Parkverwaltung der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) die Feierlichkeiten zum Heldengedenktag …
ähh: Volkstrauertag abgesagt habe. Begründung: Der HMK sei aufgefallen, dass das Ehrenmal eine „heikle Sache“ ist, weil die Gefallenen „Täter und Opfer“ seien. Außerdem würden mit den Steintafeln am Ehrenmal auch Verbände geehrt, die „eindeutig Täter“ seien. Man wolle jetzt einen „differenzierten Umgang“ … blablabla. (https://bit.ly/3dpUtij)
Auseinandersetzung in der Uni
Die Aktion und das Denkmal waren außerdem Thema an der Universität. Die Vorlesungsreihe „Denkmal-Kontroverse in Kassel“ nutzte für die Bewerbung ein Bild der Denkmal-Aktion. Das Bild zeigt eine der mit einem Aufkleber ergänzten kriegsverherrlichenden Steintafeln. Im Original lautet der Slogan „Furchtlos und treu“. Nach der Ergänzung lautete der Schluss des Slogans „Furchtlos und treudoof.“ (https://bit.ly/336M1CT)
Fazit

Machen wir uns nichts vor: Die Zeiten sind gerade günstig. Dank der aktuell fast wöchentlich öffentlich werdenden „Einzelfälle“ von braunen Soldat*innen, die für ihre Nazi-Netzwerke alles unterhalb der Größe eines Schützenpanzers aus den Kasernen schleppen, steht das Militär so sehr unter Druck wie selten zuvor. Ein offener Protestbrief hätte im aktuell sehr günstigen gesellschaftlichen Klima vermutlich Ähnliches erreicht.
Doch stellen wir uns vor, wir könnten es schaffen, offene Ansprechbarkeit, inhaltsreiche Öffentlichkeitsarbeit, freche Militanz und andere Aktionsformen lokal vor Ort zu verbinden. Welche Kraft hätten wir, politische Ziele zu erreichen! Stattdessen stellen wir Hauptamtliche ein, die in der Berliner Betonwüste ausgerechnet die grüne Kriegspartei anlobbyieren sollen.
Eines der wenigen Beispiele, bei dem die Verbindung verschiedener Politikformen in der DFG-VK gut klappt, ist der Denkmalprotest um Wilfried Porwol und die DFG-VK-Gruppe Kleve (siehe ZivilCourage Nr. 1/2021 mit der Titelgeschichte „Krieger.Denk.Mal.“). Falls euch weitere Beispiele einfallen, schreibt bitte einen Leser*innenbrief mit Aktionsbild oder eine Mail an amab@riseup.net. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Autor*inneninfo: Einige aus der Antimilitaristischen Aktion Berlin (amab). Die amab ist Teil des U35-Netzwerkes der DFG-VK und arbeitet mit im Landesverband Berlin.
In der Regel verzichten wir auf allgemeingültige Aussagen und Stellvertretung (deswegen „einige aus der amab“). Wir verzichten meistens auch auf individuelle Namensnennungen. Auf das karrieregeile Publikationen-sammeln haben wir keine Lust, und es sollte um das inhaltliche Argument statt um das Ansehen der schreibenden Personen gehen. Außerdem haben wir mittels Datenschmutz-Anfragen rausgefunden, dass ein Landesamt für Verfassungsschmutz Schreibttischtäter*innen dafür bezahlt, Publikationen nach Artikeln eines unserer Mitglieder zu durchforsten und in Datenbanken zu speichern, und dabei müssen wir ja den Geheimen nicht auch noch Hilfestellung leisten.
Auch die Streitkultur in der DFG-VK, bei der (z.B. nach dem Niemöller-Text – siehe ZivilCourage Nr. 1/2021, S. 26 ff.) regelmäßig völlig unnötig mit Namen um sich geworfen wird, sagt uns nicht zu, denn wir haben Google-Phobie (deswegen gibts auch kein Bild von uns). Unser Vertrauen, dass es bei Stress und Ärger wegen unseres Engagements Unterstützung gibt, und nicht auch noch irgendwer z.B. eine Liste mit unseren Namen an die Staatsanwaltschaft faxt, ist angesichts der Konfliktgeschichte unseres Landesverbandes mit dem Bundesverband leider nicht besonders hoch. Wir versuchen, aus Geschichte zu lernen, und setzen lieber auf Datensparsamkeit. Mehr Infos zu unserer Arbeit findet sich auf unserem Blog amab.blackblogs.org
Und was ist eine Datenschmutz-Anfrage? https://datenschmutz.de/auskunft