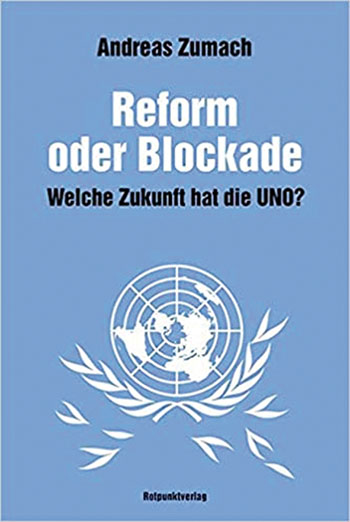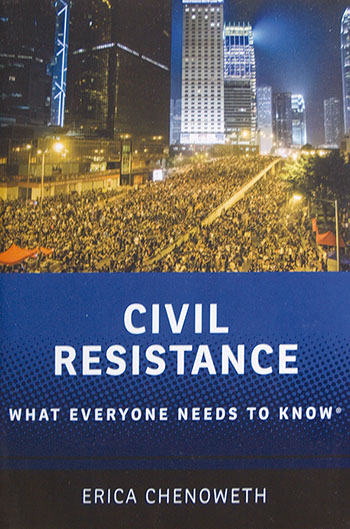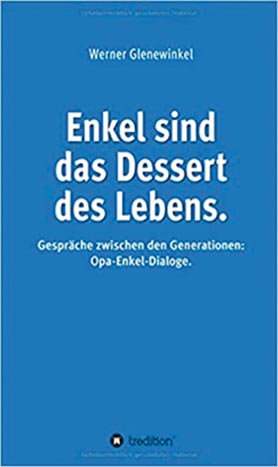| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2021 |
Literatur

Ziesar Schawetz (Hrsg.): David McReynolds – Philosophie der Gewaltfreiheit. Das pazifistische Manifest eines Marxisten. (Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ziesar Schawetz) (Nr. 10 der Reihe IDK-Texte zur Gewaltfreiheit, hrsg. von Wolfram Beyer; IDK-Verlag Berlin) Berlin 2021; 96 Seiten; 6,80 Euro (zzgl. Versandkosten); Bestellung über www.idk-info.net
Kurz und knapp: Aus der IDK, der Internationale der Kriegsdienstgegner*innen, eine 1947 gegründete (weitere deutsche) Sektion der War Resisters´ International (WRI) und Organisation, die die verschiedenen Fusionen zur DFG-VK nicht mitgemacht hat, kommen immer Broschüren mit wichtigen (Grundlagen-)Texten. Diese widmet sich dem 2018 verstorbenen David McReynolds, einem der prägenden Persönlichkeiten des Pazifismus in den USA – aber auch international, war er doch Jahrzehnte führend in der WRI tätig.
Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Der ausführliche, kenntnisreiche und einleitende Text von Ziesar Schawetz hilft bestens dabei, die eben nun historische Figur David McReynolds kennenzulernen, zu verstehen, einzuordnen und zu „bewerten“. Die beiden anderen sind Originalton David McReynolds und vielleicht besonders lesenswert für Jüngere. Sie könnten diesen zeigen: Auch „alte weiße Männer“ waren mal jung und können dennoch auch im Alter im Denken und Handeln radikal bleiben. Lesenswert!
Stefan Philipp