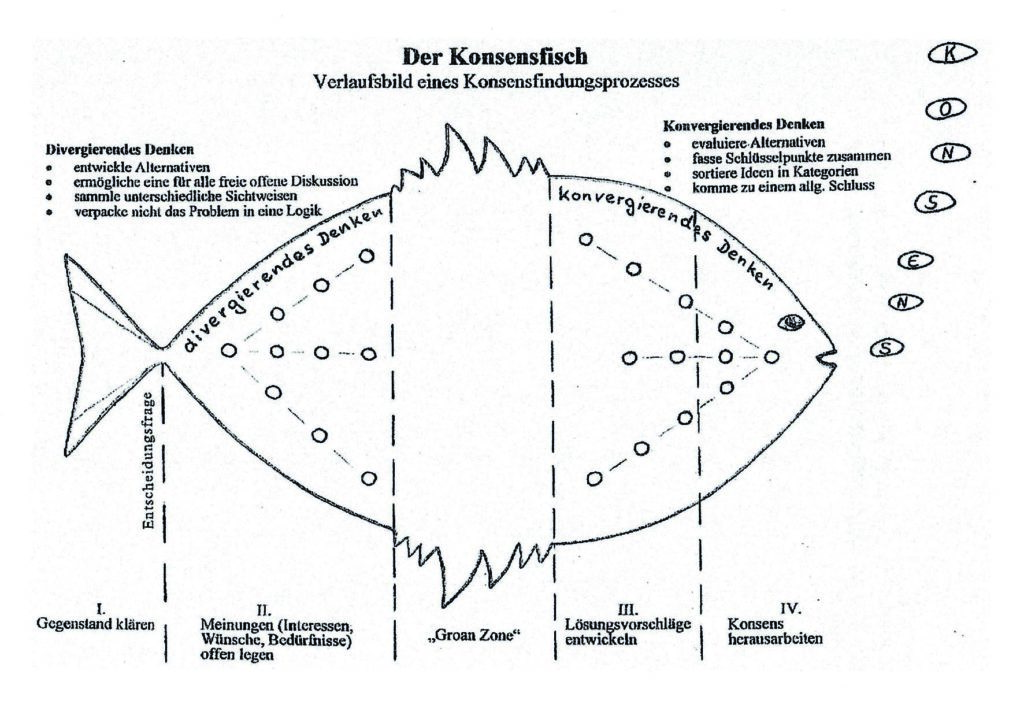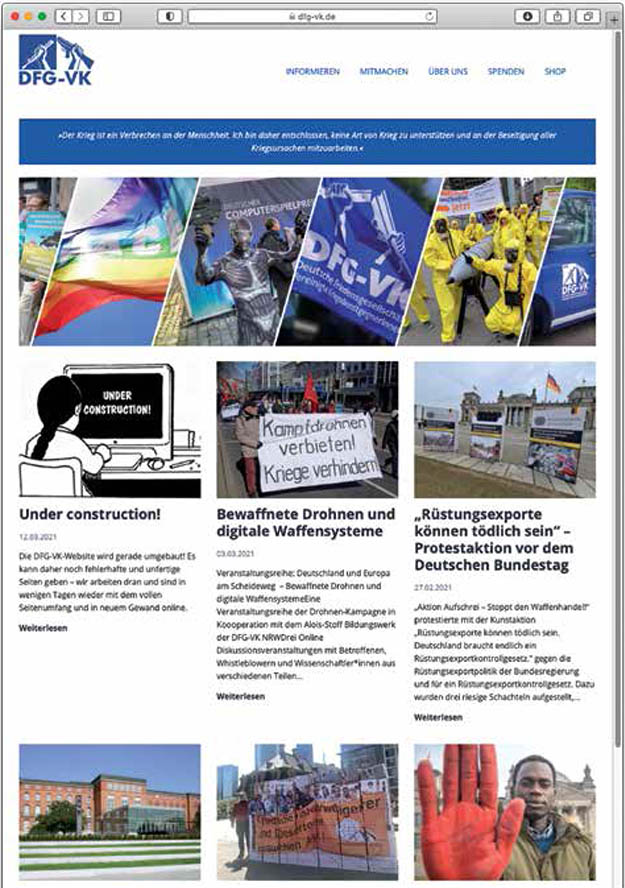| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 4/2021 |
DFG-VK-Info
Der bevorstehende DFG-VK-Bundeskongress unter Corona-Bedingungen
Von Stefan Philipp
Der DFG-VK-Bundesausschuss hat Ende August entschieden, dass der Bundeskongress wegen der Coronapandemie auf das Jahr 2022 verschoben wird. Weitere Informationen unter https://buko2021.dfg-vk.de
Bundeskongresse sind das höchste (Entscheidungs-)Gremium (lateinisch „Schoß, Innerstes“) in der DFG-VK und damit der Wesenskern demokratischer Willensbildung in unserer Organisation und der Teilhabe der Mitglieder. Nach der Satzung muss „mindestens alle zwei Jahre“ ein Bundeskongress (Buko) stattfinden.
Und so hat der Bundesausschuss (BA) im letzten Jahr beschlossen, den nächsten Buko vom 29. bis 31. Oktober 2021 in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt durchzuführen. Die organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitungen dafür laufen seit Monaten, die Jugendherberge als Tagungsort und Übernachtungsmöglichkeit für die Delegierten ist seit Langem fest gebucht. Der Vertrag dafür kann bis Anfang September kostenfrei storniert werden. Fraglich ist nämlich, ob wegen der Pandemie erlassene staatliche Vorgaben einen Kongress Ende Oktober rechtlich zulassen und ob eine solche Präsenzveranstaltung sinnvoll und verantwortbar ist.
Der BA hat deshalb auf seiner Sitzung im Juni beschlossen, sich Ende August festzulegen, ob und wie der Buko stattfinden wird. Zum Redaktionsschluss Mitte August war also noch unklar, ob die Delegierten und interessierten Mitglieder real in Halle (Saale) zusammenkommen können, ob der Kongress per Videokonferenz stattfindet oder ins nächste Jahr verschoben wird. Ab Anfang September sind alle Informationen dazu auf der Website www.dfg-vk.de zu finden.
Coronapandemie
Wie sich die Coronapandemie weiterentwickelt und welche staatlichen Bestimmungen wann gelten, ist unklar. Die Anzahl der Neuinfektionen stieg allerdings Anfang August wieder kontinuierlich an. Es ist jedenfalls nicht damit zu rechnen, dass die Pandemie Ende Oktober vorbei ist und die Beschränkungen für Versammlungen aufgehoben sind.
Bis zum 26. August galt und gilt in Sachsen-Anhalt die „14. Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2“. Nach dieser gilt bei allen Veranstaltungen, wobei „Mitglieder- und Delegiertenversammlungen“ ausdrücklich als solche genannt werden, die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern. Nach Auskunft der Jugendherberge dürften sich in dem für den Buko vorgesehenen Versammlungsraum nach dieser Vorgabe lediglich 35 Personen aufhalten. Außerdem haben alle TeilnehmerInnen der Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Und schließlich müssen alle Nicht-Geimpften täglich eine negative Testbescheinigung vorlegen oder unter Aufsicht einen Selbsttest vornehmen.
Es ist vernünftigerweise nicht davon auszugehen, dass bei einem wahrscheinlichen Anstieg der Neuinfektionen im Herbst – Stichworte: „vierte Welle“, ansteckendere Delta-Variante – weniger einschneidende Maßnahmen verordnet werden.
Ein normaler Buko mit um die 100 TeilnehmerInnen, der die satzungsmäßigen Aufgaben erledigt, scheint damit für das letzte Oktoberwochenende unwahrscheinlich. Das schafft für die DFG-VK politische, aber auch satzungsrechtliche Probleme.
Nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches für Vereine finden Mitgliederversammlungen als Präsenzveranstaltungen statt. Das ist auch der Regefall für die Bukos der DFG-VK; eine Regelung, dass ein solcher auch digital stattfinden könnte, findet sich in der Satzung nicht. Allerdings hat der Bundestag bereits am 28. März 2020 das „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ (GesRuaCOVBekG) beschlossen, dessen Paragraf 5 bis Ende 2021 befristete Ausnahmeregelungen schafft.
Deshalb könnte die DFG-VK ihren Buko auch digital, also z.B. als Videokonferenz durchführen. Und auch der Vorstand/BundessprecherInnenkreis (BSK) bliebe „auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.“
Es wäre also rechtlich nicht notwendig, einen eintägigen Buko Ende Oktober als Präsenzveranstaltung oder digital nur deshalb durchzuführen, um Rechenschaftsberichte entgegenzunehmen und den BSK sowie weitere FunktionärInnen zu wählen. Ein solcher Vorschlag wurde im Vorfeld der genannten Abstimmung des BA gemacht, verbunden mit der Idee, einen zweiten Teil mit Antragsberatung, Workshops etc. dann z.B. im nächsten Frühsommer zu veranstalten.
Der BA könnte Ende August also rechtlich unbedenklich entscheiden, den 23. DFG-VK-Bundeskongress mit dem bereits beschlossenen (oder einem geänderten) Tagesordnungsvorschlag im nächsten Jahr durchzuführen – ganz real mit anwesenden Delegierten und Mitgliedern.
Die sinnvolle politische Lösung: Verschiebung des Bundeskongresses
Das wäre aus meiner Sicht auch politisch sinnvoll. Eine der wesentlichen Aufgaben und gleichzeitig zentrales Recht des Buko ist die Wahl des BSK/Vorstands.
Zurecht erhalten Menschen, die sich dafür zur Wahl stellen, einen großen Vertrauensvorschuss und werden in der Regel gewählt. Und so sehr es geschätzt wird, wenn gerade junge Menschen für eine Mitarbeit im DFG-VK-Führungsgremium bereit sind, so befremdlich war es für viele Delegierte beim letzten Buko 2019 in Frankfurt am Main, dass dort einige Kandidaturen quasi „vom Himmel fielen“; dass sich nämlich Menschen zur Wahl stellten, die man auf Bundesebene niemals zuvor gesehen hatte, die auch nicht durch inhaltliche Beiträge beim Kongress oder zuvor eine Position bezogen hätten, die sichtbar gemacht hätte, wofür sie stehen.
Es gibt also durchaus auch kritische Fragen zum BSK und seiner Arbeitsweise in den letzten beiden Jahren. Dass diese im Rahmen einer distanzierten Videokonferenz vernünftig gestellt und umfassend beantwortet werden, ist leider nicht sehr wahrscheinlich. Da es seit Pandemiebeginn im März 2020, also kurz nach dem letzten Buko, auf Bundesebene fast ausschließlich Telefon- und Videokonferenzen mit begrenzten Möglichkeiten zu vertiefter inhaltlicher Arbeit gab, wären Wahlen bei einem zweigeteilten Buko mit Formalien im Oktober und einem inhaltlichen Teil im nächsten Jahr der falsche Weg.
Mitgliedsbeitrag ab 2022 freiwillig erhöhen
Bleibt ein Problem: Für den Buko liegt ein Antrag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vor. Das ist traditionell ein äußerst umstrittenes Thema in der DFG-VK, das intensiv diskutiert werden muss. Sollte der Kongress verschoben werden, würde eine Erhöhung, so sie denn beschlossen wird, erst 2023 die Verbandsfinanzen verbessern.
Meine Lösung, die ich zur Nachahmung ermpfehle: Ich erhöhe meinen Monatsbeitrag ab dem 1. Januar 2022.
Stefan Philipp ist Chefredakteur der ZivilCourage. In der Ausgabe 5/2020 (Seite 28 f.) hat er sich unter der Überschrift „Die DFG-VK-Satzung, das unbekannte Wesen“ vor allem mit den Aufgaben des BundessprecherInnenkreises beschäftigt.