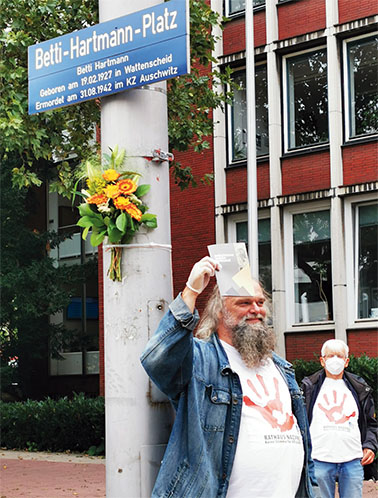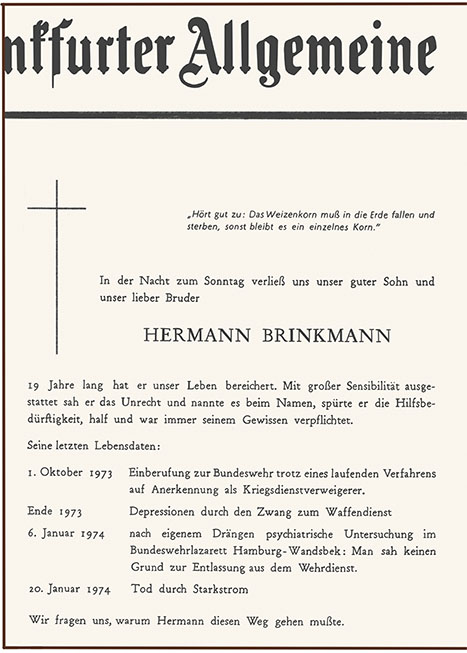Militarisierung, Aufrüstung und Widerstand in Zeiten der Corona-Pandemie
Von David Scheuing

In den vergangenen Monaten sind eine Reihe von militärischen Konflikten wieder neu angefacht worden, der erstarkte Autoritarismus weltweit schlägt sich in teils massiver Militarisierung und Aufrüstung nieder und antimilitaristische Stimmen werden (nicht nur in diesen Kontexten) oftmals unterdrückt. Keine leichte Situation für Protest, Widerstand und Aktionen – erst recht nicht in einer Pandemie.
Nagorny-Karabach: Profiteure, Kriegstreiber, Widerstand. Es wird wieder aktiv Krieg geführt in Nagorny-Karabach, auf beiden Seiten mit vollständiger Mobilmachung. Auf der Seite der Gewaltakteure und -profiteure müssen dabei viele Interessen und externe Einflüsse mitbedacht werden. In den Monaten vor den kriegerischen Handlungen kaufte Aserbaidschan beispielsweise ein Vielfaches seiner sonstigen Waffen und militärischer Ausrüstung bei der Türkei (https://reut.rs/2TYGtSQ). Der langjährige Machthaber in Aserbaidschan, Aliyev, wähnt sich auf jeden Fall siegessicher aufgrund der deutlichen Gebietsgewinne, die das Militär erlangt hat. Seine direkte Unterstützung durch die türkische Regierung spielt hierbei eine maßgebliche Rolle.
In Aserbaidschan ging die Regierung gleichzeitig massiv gegen eine kleine Gruppe von Antimilitarist*innen und Anarchist*innen vor. Giyas Ibrahimov, ein lautstarker Kritiker der Regierung in Baku, wurde gleich zu Beginn der kriegerischen Handlungen am 29. September festgenommen – wegen „zersetzender Antikriegspropaganda“. Antimilitaristische Aktivist*innen haben allerdings auch innergesellschaftlich einen schweren Stand, werden sie doch als anti-nationale Agitatoren gesehen (https://bit.ly/3691U9J).
Auf dieses Statement folgte die Erklärung von 17 Aktivist*innen am 30. September, die weitaus größeren Widerhall fand (hier in deutscher Übersetzung: https://bit.ly/3mYeCyD). Einer der Unterzeichner*innen wurde von OpenDemocracy interviewt, Connection hat das Interview übersetzt. Lesenswert! Bahruz Samadov bestätigt darin die Einschätzung, dass vor allem der extreme Nationalismus vieler Bürger*innen für Drohungen gegenüber Aktivist*innen verantwortlich sei. Er nährt gleichzeitig die Hoffnung, dass es eine echte Opposition in Aserbaidschan gibt, die sich gegen den Krieg und den Hass zwischen Armenier*innen und Aserbaidschaner*innen ausspricht (https://bit.ly/2I5PDuF).
Verweigerer*innen haben in Aserbaidschan keine Rechte und werden verfolgt, entsprechenden Formulierungen eines „alternativen“ Dienstes in der Verfassung zum Trotz (https://bit.ly/367VgQW).
Armenien wiederum fürchtet mit Blick auf die Geschichte und das Trauma des Völkermords zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu Recht die Beteiligung der Türkei am Konfliktgeschehen. Die Regierung Erdoğan versucht seit vielen Jahren, von innenpolitischen Problemen durch außenpolitische Volten abzulenken – so verwundert auch diesmal die Intervention nicht. Sie steht auch in einer gewaltvollen Tradition der türkischen Regierung, fasst der türkische Kriegsdienstverweigerer Beran Mehmet İşci zusammen. Er analysiert die Rolle der Türkei in diesem Beitrag: https://bit.ly/389CgnX
Mit Blick auf Armenien bleibt bemerkenswert, dass der Ministerpräsident, der sich selbst durch eine gewaltfreie Revolution an die Spitze des Staates arbeitete (siehe ZC 03/2018, 05/2018), seit 2019 eine unbedingte Eingliederung der Region nach Armenien verlangt. Dies trug sicherlich zur Eskalation des Konfliktes bei, da sowohl Aserbaidschan als auch Russland dies als Kampfansage für einen politischen Lösungsprozess des Konfliktes betrachteten. Den gewaltsamen Angriff im September dieses Jahres rechtfertigt dies keinesfalls. Doch wie vorauszusehen war, ist Paschinjan kein Pazifist (ZC 05/2018).
Auch in Nagorny-Karabach wird die KDV nicht akzeptiert. Viele Verweigerer*innen werden wegen Befehlsverweigererung zu hohen Haftstrafen verurteilt. Ähnliches gilt für Armenien, wo zuletzt Ende Oktober die Haftstrafen für KDVer empfinlich verschärft wurden (https://bit.ly/3mRYDlR).
Den Krieg im Jemen beenden: neue Gerichtsverfahren in Großbritannien und Belgien. Nach den erfolgreichen Verfahren von Aktivist*innen in Großbritannien gegen Lieferungen nach Saudi-Arabien, die die britische Regierung danach schlicht durch Anpassung ihrer Mitteilungspolitik unterlief (ZC 03/2020), ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ende Oktober startete CAAT erneut ein Verfahren gegen die britische Regierung, da die Kampagne die Einschätzung der Regierung für bloße Augenwischerei hält. Von „vereinzelten Menschenrechtsverletzungen“ könne bei Hunderten von Angriffen gegen Wohngebiete, Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen in keiner Weise mehr gesprochen werden. Mehr zum neuen Verfahren hier: https://bit.ly/3mVh3Ck
In Belgien hat eine Koalition von CNAPD, LDH, Amnesty International und Vredesactie ein Verfahren beim Staatsrat, dem obersten Verwaltungsgericht, gegen die fortgesetzten Exporte der belgischen Waffenproduzenten nach Saudi-Arabien angestrengt. In einem ersten Verfahren war ein teilweises Exportverbot erreicht worden, allerdings durften Lieferungen an die königliche Hofwache geliefert werden, da sie nach Auffassung des Gerichtes nicht im Krieg in Jemen eingesetzt werden würde. Nach Recherchen von Vredesactie steht das allerdings in Zweifel. Nun müssen die Richter*innen sich mit diesen neuen Recherchen beschäftigen (https://bit.ly/3l0QDhN).
Unterstützung aus der Ferne – auch in einer Pandemie. Nicht immer können wir Aktive vor Ort sein, aber unsere Solidarität und Unterstützung gilt Menschen in einer bedrohlichen oder gewaltvollen Situation. Aus den Erfahrungen der Unterstützungsgruppe der WRI für politisch Verfolgte in der Türkei ist jetzt die wertvolle Broschüre „Protection from Afar“ entstanden, die sich eben genau dieser Herausforderung annimmt und auch direkt auf andere Kontexte anwendbar sein kann. Die Broschüre ist auf Englisch erschienen und kann über Connection bezogen werden: https://bit.ly/365rdcz
EGMR: Fatale Entscheidung zu Rechten von KDVer in Russland. In einer Entscheidung vom März 2020, die durch die Ablehnung einer Berufungsverhandlung im September jetzt gültig wurde, entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass Russland die Rechte eines Klägers nach Artikel 9 der europäischen Menschenrechtscharta (Recht auf freie Meinungsäußerung, Religions- und Glaubensfreiheit) nicht verletzt habe. Dem Verweigerer war aufgrund „unzureichender Begründung“ die Verweigerung verwehrt worden, der EGMR entschied, die dafür zuständige Kommission sei „ausreichend unabhängig“. Die knappe Vier-zu-drei-Mehrheit der Kammer zeigt, dass genügend Richter*innen eine fatale Verletzung der Rechte des Klägers vorliegen sahen. WRI, Ebco, Ifor und Connection haben den Gerichtshof für diese Entscheidung hart kritisiert: https://bit.ly/3ezdGxR
USA: Neuregelung der Rekrutierung geht voran. Nach der Wahl geht die Arbeit weiter. Konkret steht in den USA die Entscheidung entweder für eine Beendigung aller Einzugsregelungen und des „Selective Service“ oder eine Ausweitung der Rekrutierung auch auf Frauen* aus. Ein breites Bündnis von Aktivist*innen und Organisationen hat jetzt die Chance, einer Resolution zur Beendigung Schub zu verleihen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist im Kongress eingebracht und soll 2021 diskutiert werden. Mehr Informationen bei „World Beyond War“ (https://bit.ly/3mTGTX9).
Thailand: Proteste für Demokratie gewaltsam aufgelöst. Die jungen und friedlichen Demokratieproteste in Thailand, die eine Reform der Monarchie fordern, sind Mitte Oktober mehrfach gewaltsam aufgelöst worden. Human Rights Watch hat dabei diverse Brüche internationaler Menschenrechtsstandards dokumentiert: https://bit.ly/367WUSC
Die Wasserwerfer, die hier zum Einsatz kamen, stammen vom koreanischen Produzenten „Jino Motors“, der in der Vergangenheit auch fleißig an Kunden wie Syrien, Jemen oder Indonesien geliefert hat. Aktivist*innen in Südkorea haben Ende Oktober darauf gedrängt, solche Waffenverkäufe zu stoppen. Hier mehr dazu: https://bit.ly/3l3fz8C
Desinvestition, Entmilitarisierung und Abrüstung: Zwischenruf der WILPF. Die internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit hat einen nötigen Zwischenruf fürs Innehalten und Umdenken in Zeiten der Pandemie formuliert. Ray Acheson bringt darin zum Ausdruck, dass es Zeit dafür ist, Kriegs(güter)investitionen zurückzunehmen, Gesellschaften zu entmilitarisieren (auch durch eine Entpatriarchalisierung der Gesellschaft) und eine allgemeine Abrüstung zu starten. Die Pandemie mache das mehr als überdeutlich sichtbar, denn „derzeit sind wir bis an die Zähne bewaffnet, ohne noch das Geld für eine simple Gesichtsmaske über zu haben“. Es ist Zeit dagegen etwas zu unternehmen! Der ganze Text findet sich hier: https://bit.ly/3oY3ROS
Griechenland: Wieder Verweigerer gerichtlich verfolgt. Der griechische Staat führt derzeit ein Verfahren gegen einen Verweigerer aus dem Jahr 2004 (!). Im Verfahren scheint es aber nicht um die Strafgebühren wegen des nicht angetretenen Kriegsdienstes zu gehen, diese wurden bereits von seinem Konto konfisziert. Viel eher scheint es um eine generelle Verhandlung seiner Verweigerung und den Antrag auf Ersatzdienst zu gehen, die damals abgelehnt wurden. Das europäische Büro für Kriegsdienstverweigerung (Ebco) zählt über die letzten 15 Jahre mehrere Menschenrechtsverletzungen gegenüber dem Verweigerer durch den griechischen Staat. Das Verfahren wird von griechischen Antimilitarist*innen und Ebco beobachtet. Mehr hier: https://bit.ly/3etnZUj
David Scheuing ist Vertreter der DFG-VK bei der War Resisters´ International (WRI), dem internationalen Dachverband der DFG-VK mit Sektionen in weltweit 45 Ländern, gewählt. An dieser Stelle berichtet er regelmäßig in der ZivilCourage aus der WRI, um den LeserInnen das globale Engagement von KriegsgegnerInnen sichtbar zu machen. Das sind keine tieferen Analysen, sondern kleine kursorische Überblicke und Nachrichten; es geht dabei nicht um Vollständigkeit, vielmehr um Illustration. Ideen und Vorschläge für kommende Ausgaben sind erwünscht. Der Autor ist per E-Mail erreichbar unter scheuing@dfg-vk.de