Ausgabe 5/2020

Ausgabe 5/2020

Ausgabe 5/2020

Soldatinnen und Soldaten!
Schon wieder eine gute Nachricht für uns! Nein, nicht von der Corona-Front, sondern von ganz oben. Ist alles noch ziemlich intern, also bitte so behandeln: Wir bekommen ab dem Oktober 2021 einen neuen Dienstgrad zwischen den Mannschaftsdienstgraden und Uffz. Künftig kann also ein Oberstabsgefreiter zum – na, wie soll er heißen? – Korporal (oder Corporal im breitesten Amerikanisch) befördert werden. Über die Rangabzeichen ist noch nicht entschieden, aber wie man so hört, soll ordentlich Lametta dabei sein, zumindest auf der Ausgehuniform. Möglich wurde das durch das Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz. Wurde ja auch Zeit für 19. Jahrhundert reloaded; in Preußen wurde der Korporal schon 1853 abgeschafft, und wir beleben ihn im Rahmen der Traditionspflege. Kameraden, das wird richtig gut, wenn bald auch bei den Offizieren die alten Dienstgrade wieder kommen: Rittmeister, Feldzeugmeister, Flügeladjutant, Generalfeldmarschall – wie in alten Zeiten!
gez. Alex von Lingua, Feldpostmeister
Opladen, Berlin, Toronto 2020; 3., aktualisierte und erweiterte Auflage; 358 Seiten; 34,90 Euro
„Eine friedliche Welt ist (noch) möglich“
Ausgabe 5/2020
Literatur-Empfehlung
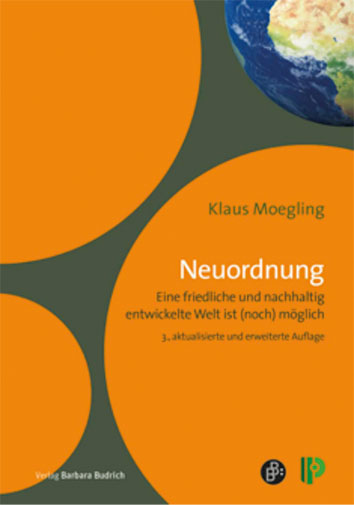
Während die AkteurInnen und Akteure für Frieden, Solidarität und Nachhaltigkeit in ihrer Argumentation und ihrem Engagement verständlicherweise auf ihren jeweiligen Bereich fokussieren, versucht der Kasseler Gesellschaftswissenschaftler Klaus Moegling, die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Perspektive bewusst zu machen. Politische, ökonomische, ökologische, zwischenmenschliche und psychische Ordnungen seien in einem umfassenden Sinne in einer Verbindung zu begreifen. So schildert er beispielsweise in eindrücklicher Weise die ökologischen Folgen von Kriegen und Rüstung und sieht einen langfristigen Bedeutungsgewinn der internationalen Umweltbewegung der jungen Generation, wenn diese in ihrem Engagement Kontakt zur Friedensbewegung aufnimmt, was auch umgekehrt gelten dürfte.
Die Breite der fundierten Problemanalyse ökonomischer Strukturen, über das Erstarken autoritärer Herrschaftsformen, Hegemoniestreben der Großmächte mit ihren Stellvertreterkriegen, ökologischen Krisen bis hin zu kulturellen und psychischen Krisen aber auch der vielen daraus herausführenden Initiativen machen dieses Buch zu einem gut lesbaren Kompendium für Menschen, die sich mit dem Status quo nicht zufrieden geben wollen. Auch wenn man/frau sich dann wieder auf ein Projekt konzentrieren sollte, ist der Blick aufs Ganze, das Wissen um die anderen Baustellen und ihren Interdependenzen von großer Bedeutung auf dem Weg zu einer menschenfreundlichen Neuordnung.
Ein besonderes Gewicht legt der Autor auch auf die Neuordnung des Systems internationaler Beziehungen, indem er die Bausteine für die Entwicklung einer Global Governance erläutert und kurz-, mittel- und langfristige Entwicklungsschritte für die kommenden fünfzehn Jahre beschreibt. Insofern ist dieses bereits in dritter, aktualisierter Auflage erschienene Buch eine große Hilfe, den Blick zu weiten, aber auch um Zielperspektiven zu bekommen, auf die es sich hinzuarbeiten lohnt – ein wichtiges Grundlagenbuch für jegliche politische Arbeit und für das Studium gesellschaftswissenschaftlicher Fächer.
Dass von der Evangelischen Landeskirche in Baden mit dem im April 2018 veröffentlichten Buch „Sicherheit neu denken. Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik.“ ein Szenario bis zum Jahr 2040 beschrieben ist, das mit vielen der von Moegling aufgezeigten Zielen identisch ist, jedoch noch zusätzlich einen konkreten, in Deutschland beginnenden politischen Realisierungsweg dorthin beschreibt, könnte in der erwünschten 4. Auflage von „Neuordnung“ noch ergänzt werden. Auch dass sich dafür 15 bundesweite Friedensorganisationen (BSV, DFG-VK, Eirene, IPPNW, Ohne Rüstung leben, Pax Christi u.a.) dafür zu einer Kampagne zusammengeschlossen haben, zeigt den verbreiteten starken Veränderungswillen zu einer friedlicheren Neuordnung.
Theodor Ziegler
Ein sehr persönlicher Nachruf auf Otfried Nassauer
Ausgabe 5/2020
Von Jürgen Grässlin
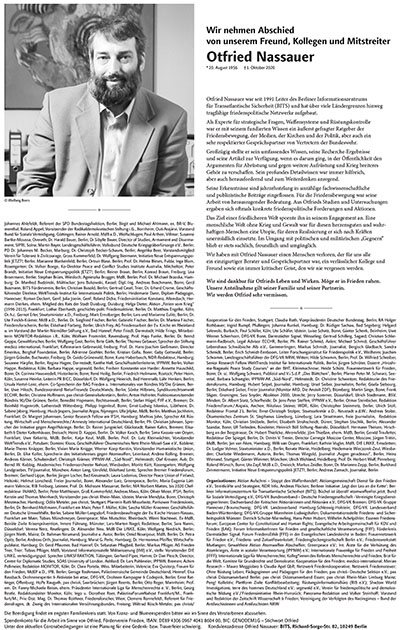
Ende Februar, noch vor dem Lockdown, haben wir uns abends und bis tief in die Nacht in deiner Lieblingskneipe in Berlin getroffen. „Speiches Rock und Blues Kneipe“ in der Raumerstraße war gut besucht, wir standen eng gedrängt, haben die Live-Musik genossen. Du warst mit der Bedienung befreundet, hast viele Besucher näher gekannt. Wir haben gelacht und getrunken, ernsthaft diskutiert und später am Abend einfach nur noch rumgeblödelt. Tief in der Nacht haben wir uns umarmt und guter Dinge „bis bald“ verabschiedet.
Wegen der Corona-Krise und auch der Entfernung Freiburg-Berlin haben wir in den Folgemonaten nur noch telefoniert. Wie seit Jahren schon gegen Mitternacht oder danach, oftmals bis zwei Uhr. Fast immer ging es um Rüstungsexporte, um Heckler & Koch, Sig Sauer, deine Türkei-Recherchen für das BITS und-und-und. Wir haben unsere Insiderinformationen ausgetauscht, aus unterschiedlichen Kanälen, aus Militär- und Rüstungskreisen, von Whistleblowern – das war äußerst informativ und damit sehr hilfreich.
Wie so oft haben wir uns dann die entsprechenden Unterlagen zugeschoben, haben weiter recherchiert und letztlich publiziert. Der Gegenseite dürfte das nicht gefallen haben. Denn aus unserem Austausch ist nicht selten Unangenehmes entstanden für die Händler des Todes, eine Vielzahl kritischer Fachartikel, Interviews, zuweilen Strafanzeigen.
Ende September haben wir einmal mehr telefoniert, tief in der Nacht versteht sich. Wenige Tage danach erreichte mich aus dem Kreis der engen Freunde die Mailmeldung: Otfried ist gestorben in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober. Bis heute habe ich diese Nachricht nicht wirklich verarbeitet. Keine Abschiedsworte, kein letzter Wunsch, nichts.
Wenigstens konnte ich in der Textgruppe für die Abschiedsanzeige in der Taz mitarbeiten. Dankenswerter Weise hat das Team um Kristian Golla viel organisiert, die ganzseitige Anzeige in der Taz geschaltet. Zahlreiche Wegbegleiter haben sich dort zusammengefunden. Eigens wurde von der Friedenskooperative eine würdigende Website zu Begegnungen und entsprechenden Fotos ins Leben gerufen (http://archiv.friedenskooperative.de/otfried-nassauer/).
Auf meinem Schreibtisch steht ein Bild von dir, du lächelst sympathisch. Dein lautes Lachen und deinen unbändigen Humor bewahre ich in mir. Und doch, lieber Otfried, du fehlst mir – nicht minder vielen von uns.
Jürgen Grässlin ist Mitglied im DFG-VK-BundessprecherInnenkreis.

Dieser Beitrag ist erschienen in der Ausgabe 5/2020
Friedenskultur
„Musik für Frieden und Gerechtigkeit“
DFG-VK-Friedenssong-Wettbewerb wegen Corona auf 2022 verschoben
Von Helmut Jawtusch

Vor zehn Jahren hatte die DFG-VK-Gruppe Bonn-Rhein-Sieg die Idee, eine Musikseite für neue Friedenslieder zu kreieren. Mit diesen Friedensliedern sollten auch Personen angesprochen werden, die außerhalb der Friedensorganisationen stehen, sich aber Sorgen machen über die anhaltende Aufrüstung, Auslandseinsätze der Bundeswehr und Kriege, die oft von außen mit Hetze, Geld und Waffen angeheizt werden. Viele Gruppen des rechten Spektrums haben Bands, die mit Musik zu Hass und Gewalt anstacheln. Wir wollen mit unseren Friedensliedern dagegen das Engagement für mehr Mitmenschlichkeit und Solidarität fördern und zum Nachdenken darüber anregen, wie wir Konflikte ohne Gewalt lösen können.
Es zeigte sich aber, dass ein Anreiz fehlte, eigene Friedenslieder zu ersinnen und auf die Musikseite hochzuladen. Die zündende Idee war nun, einen Deutschen Friedenssong-Wettbewerb zu organisieren und durch Preisgelder sowie ein abschließendes Konzert Interessierte dazu anzuregen, eigene Friedenssongs mit Texten, Melodien und Tonaufnahmen zu erstellen und auf der Musikseite hochzuladen.
Der Start war 2012 mit immerhin 30 Einreichungen und einem Preisgeld von 2 100 Euro. 2015 hatten wir über 100 Einreichungen bei 5 300 Euro Preisgeldern. Für 2018 haben wir den Betrag für die fünf Preise auf 5 750 Euro erhöht, weil wir den vierten Preis auf 750 Euro und den fünften auf 500 erhöht haben. Mit diesen attraktiven Preisen setzen wir gezielt Anreize, beim Wettbewerb mitzumachen, und zeigen auch unsere hohe Anerkennung für die Leistung der Musikerinnen und Musikern.
Auf unserer Musikseite friedensmusik.de sind nun schon 322 Songs, die sich jeder anhören und auch herunterladen kann. Inzwischen besuchen täglich zwischen 300 und 500 Personen unsere Seite.
Die Lieder dürfen keiner Musikverwertung wie etwa einer Gema-Bindung unterliegen, da wir als nicht-kommerzielle Gruppe die Kosten dafür nicht aufbringen können und urheberrechtliche Komplikationen vermeiden wollen. Dies gilt nur für den Texter sowie den Komponisten, nicht für die beteiligten Musiker und Interpreten.
Der Deutsche Friedenssong-Wettbewerb ist als gemeinsames Projekt der gesamten DFG-VK konzipiert und wird in der Werbung auch so dargestellt. Die Kosten für den Wettbewerb und das Abschlusskonzert werden durch die DFG-VK-Gruppenbeiträge, durch Verkäufe der zu den Wettbewerben erstellten CDs, sowie Unterstützer-Spenden aufgebracht. So unterstützt der Bundesverband den Musik-Wettbewerb mit jährlich 800 Euro. Auch einzelne Gruppen, wie z.B. DFG-VK-Gruppe Köln unterstützen den Wettbewerb, indem sie zu günstigen Bedingungen 25 CDs kaufen, um sie weiterzuverkaufen oder z.B. an Jubilare zu verschenken. Auch Einzelpersonen fördern durch Kauf der CDs und Spenden immer wieder den Musik-Wettbewerb. Für uns stellt die Finanzierung einen enormen Kraftakt dar. Den größten Posten der Finanzierung von insgesamt ca. 12 000 Euro und der ehrenamtlich hohe Zeitaufwand für Organisation und Durchführung stemmt die DFG-VK-Gruppe Bonn-Rhein-Sieg.
Aufruf an alle DFG-VK-Gruppen: Werben und verlinken. Was uns immer wieder auffällt: Auf den Deutschen Friedenssong-Wettbewerb machen nur wenige DFG-VK-Gliederungen auf ihren Webseiten z.B. durch einen gesetzten Link aufmerksam. Deshalb unsere Bitte: Lasst uns gesamtverbandlich für den Friedenssong-Wettbewerb werben. Jeder Link, jeder Text, der auf den Wettbewerb aufmerksam macht, ist hier hilfreich und eine wertvolle Unterstützung.
Wegen der auch für 2021 zu erwartenden Corona-Auflagen haben wir nach kontroverser Diskussion im Wettbewerbsteam entschieden, den nächsten Wettbewerb um ein Jahr auf 2022 zu verschieben. Bis dahin kann jeder bereits schon jetzt neue Friedenssongs auf der Webseite hochladen, um sie dann 2022 zum Wettbewerb einzureichen.
Helmut Jawtusch ist aktiv in der DFG-VK-Gruppe Bonn-Rhein-Sieg und engagiert sich im Team des Friedenssong-Wettbewerbs. Die URL der Website ist: https://friedensmusik.de
„Formalkram“ oder Kern demokratischen Selbstverständnisses und Handelns?
Von Stefan Philipp
Ausgabe 5/2020
Jeder Hasenzuchtverein hat sie, jeder Sportverein hat sie, und auch die DFG-VK: eine Satzung. Nach dem Duden-Bedeutungswörterbuch enthält eine Satzung „schriftlich niedergelegte verbindliche Bestimmungen, die alles das, was eine bestimmte Vereinigung von Personen betrifft, festlegen und regeln.“
Dass sich Menschen in Vereinen zusammenschließen dürfen, ist in Deutschland von der Verfassung garantiert und als Grundrecht geschützt. Artikel 9 des Grundgesetzes sagt: „Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.“
Juristisch geregelt ist das Vereinswesen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Darin heißt es, dass die „Verfassung eines (…) Vereins (…) durch die Vereinssatzung bestimmt“ wird.
Man mag solche Verrechtlichung für überflüssigen „Formalkram“ halten, geht es doch in einer Organisation wie der DFG-VK um das große Ziel des Friedens in der Welt und konkrete Aktionen. Aber wie in der großen (Staats)Verfassung geht es in der kleinen Vereinssatzung um Teilung und Kontrolle von Macht und Einfluss, um demokratische Teilhabe und fairen Interessensausgleich; letztlich um die Ersetzung des „Rechts des Stärkeren“ durch die „Stärke des Rechts“ und die Absage an das Prinzip „Der Zweck heiligt die Mittel“.
Eine solche „Regelbasierung“ ist oft mühsam, braucht Zeit, kann aufwändig sein.
Das alles gilt auch für die Satzung und die Kompetenz- und Zusammenarbeitsregeln der DFG-VK. Häufig ist die Satzung aber selbst im Bundesverband aktiven FunktionärInnen nur in groben Zügen vertraut. Deshalb sollen in unregelmäßiger Folge in der ZivilCourage einige Fragen der inneren Ordnung der DFG-VK thematisiert werden, beginnend hier mit dem BundessprecherInnenkreis (BSK).
Das Leitungsorgan der DFG-VK ist der BSK, die Satzung sieht ihn als Kollegialgremium von gleichberechtigten Mitgliedern vor. Seine Entscheidungen muss er mit jeweils einer Zweidrittel-Mehrheit der „teilnehmenden Mitglieder“ treffen. Zu der Zeit, als diese Bestimmung formuliert wurde, hätte sich wohl niemand vorstellen können, dass es einmal eine Pandemie geben würde, die physische Treffen erschwert und dazu führte, dass BSK-Sitzungen in diesem Jahr bisher nur als Videokonferenzen stattfinden konnten. Die Satzung lässt die äußere Form der Entscheidungsfindung aber offen, erlaubt also neben Sitzungen, bei denen sich die Mitglieder real treffen, auch andere Formate wie Telefon- oder Videokonferenzen oder auch gemischte Formen, bei denen sich ein Teil der Mitglieder physisch trifft und andere sich telefonisch oder per Videoübertragung zuschalten; genauso möglich wären auch rein schriftliche Entscheidungsprozesse. Entscheidend ist allein, dass mindestens die Hälfte der Mitglieder sich an einer Entscheidung beteiligt, andernfalls ist der BSK nicht beschlussfähig.
Eine von der Satzung vorgesehene Möglichkeit zur Kontrolle des BSK ist dessen Berichtspflicht gegenüber dem Bundesausschuss (BA) und die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Bundeskongress. Ob der BA wirklich umfassend informiert wird, z.B. durch regelmäßige Berichte bei seinen vier Sitzungen im Jahr, können die BA-Mitglieder begrenzt dadurch nachvollziehen, dass die Protokolle der BSK-Sitzungen veröffentlicht werden. Abrufbar sind sie in der DFG-VK-Cloud, in der sich jedes Mitglied anmelden kann
(https://cloud.dfg-vk.de; vgl. Beitrag über die Cloud in ZivilCourage Nr. 4/2020, Seite 28).
Die Satzung schreibt für alle BSK-Entscheidungen eine Zweidrittel-Mehrheit vor. Ein Blick in die Protokolle zeigt, dass die Arbeitsweise des BSK von großer Harmonie und Einmütigkeit geprägt zu sein scheint; Abstimmungen finden dort nicht statt, jedenfalls sind keine protokolliert.
In den meisten DFG-VK-Pressemitteilungen liest man, die DFG-VK-Bundessprecherin X habe dies oder der DFG-VK-Bundessprecher Y habe jenes erklärt. Eine solche Bezeichnung als „DFG-VK-BundessprecherIn“ ist fragwürdig: Dahinter verschwindet, dass es eben nicht nur einen oder eine (Bundes-)SprecherIn gibt, sondern einen Kreis gewählter Personen, der als DFG-VK-Leitungsgremium Politik gemeinsam entwickelt. Richtiger wäre also, Einzelpersonen aus diesem Gremium als Mitglied(er) im BundessprecherInnenkreis zu bezeichnen (wie es in der ZivilCourage auch seit Langem praktiziert wird).
Historisch ist es so, dass die DFG-VK viele Jahre einen auch als solchen bezeichneten Bundesvorstand hatte. Als die Deutsche Friedensgesellschaft-Internationale der Kriegsdienstgegner (DFG-IdK) mit dem Verband der Kriegsdienstverweigerer (VK) 1974 zur DFG-VK fusionierte, gab es zwei gleichberechtigte Bundesvorsitzende, Helmut-Michael Vogel, zuvor DFG-IdK-Vorsitzender, und Klaus Mannhardt, vormals VK-Vorsitzender. Damit wurden auch die Traditionslinien der Vorläuferorganisationen personell repräsentiert.
Zugleich gab es damit aber auch, im Gegensatz zu den meisten anderen Organisationen, ein „antihierarschisches“ Element, denn die übliche Struktur kannte ein/n Vorsitzende/n und häufig zwei oder mehr stellvertretende Vorsitzende sowie „Beisitzer“ genannte weitere Vorstandsmitglieder. In der Regel bildeten Vorsitzende/r und StellvertreterInnen den sog. geschäftsführenden Vorstand. Das Konzept eines BSK mit gleichberechtigten Mitgliedern setzt auf Partizipation und „gleiche Augenhöhe“.
Mindestens in der Theorie. In der Praxis kann man, z.B. im Bundesausschuss als dem nach dem Bundeskongress zweithöchsten DFG-VK-Entscheidungsgremium, den Eindruck gewinnen, dass manche BSK-Mitglieder wichtiger und einflussreicher sind als andere.
Früher war es üblich (und hat auch zu „Kampfabstimmungen“ geführt), die unterschiedlichen politischen Strömungen im Leitungsgremium abzubilden. Politische Kontroversen über Einschätzungen und Strategien wurden dann dort geführt und geklärt. Mittlerweile sind die Strömungen nicht mehr so profiliert und organisiert. Ein Versäumnis der DFG-VK insgesamt war es, sich nicht ausreichend um Nachwuchs zu kümmern und eine intensive Mitgliederwerbung zu betreiben. Die Folge ist eine Überalterung der Organisation.
Zwar ist es in den letzten Jahren gelungen, auch wieder jüngere Menschen für pazifistisch-antimilitaristisches Engagement in der DFG-VK zu gewinnen, es fehlen aber die „mittelalten“ Jahrgänge zwischen 35 und 50. Durch das Bemühen, Nachwuchs zu gewinnen, und weil der BSK durch die Satzung zahlenmäßig nicht begrenzt ist, wurden bei den letzten Bundeskongressen verstärkt junge Menschen in den BSK gewählt – unabhängig von ihrer Kenntnis des Verbandes, seiner Erfahrungen und Praxis und von eigener Erfahrung und Qualifikation, die z.B. im Engagement in Gruppen oder Landesverbänden erworben worden wären.
Eine Besonderheit in der Leitungsstruktur der DFG-VK liegt in der Spezialregelung, dass der Bundeskongress aus der Mitte des (zuvor gewählten) BSK den/die BundeskassiererIn und mindestens zwei weitere Mitglieder wählt. Nach § 26 BGB muss jeder Verein einen Vorstand haben, der ihn rechtlich vertritt, z.B. den Mietvertrag für die Räume der DFG-VK-Bundesgeschäftsstelle unterschreibt. Theoretisch und rechtlich möglich wäre es natürlich, sämtliche BSK-Mitglieder in diesen Vorstand zu wählen, so dass (rechtlicher) Vorstand und (politischer) BSK identisch wären. Das war aber auch wegen möglicher Haftungsfragen nicht gewollt.
In der politischen Arbeit der DFG-VK ändert sich durch diese Satzungsbestimmung allerdings nichts. Einzige Aufgabe des (BGB-)Vorstandes ist es, Entscheidungen des dafür allein zuständigen und legitimierten BSK ggf. juristisch und formal umzusetzen. Eine eigene „Gestaltungsmacht“ sollte dieser BGB-Vorstand nicht haben und hat sie nach der Satzung auch nicht; alle in § 12 Abs. 1 der Satzung genannten Rechte und Verpflichtungen beziehen sich auf den BSK.
Die Internetseite mit der DFG-VK-Satzung ist überschrieben mit dem Satz „Auch wer die Welt verändern will, muss sich an Regeln halten“. So viel Pathos ist gar nicht nötig, die Satzung als verbindliche Handlungsanweisung zu beachten, würde schon reichen.
Stefan Philipp ist ZivilCourage-Chefredakteur. In den 80er Jahren war er Mitglied im DFG-VK-Bundesvorstand
Die Gruppe Köln hat nachgefragt
Ausgabe 5/2020
Von Michael Sünner

Es ist sicher kein Zufall, wenn ein Mensch bei uns in der DFG-VK Mitglied wird. Uns in der Gruppe Köln interessierten die verschiedenen Faktoren, die hierbei von Bedeutung sind, und wir führten eine Befragung der in den letzten drei Jahren eingetretenen Mitglieder durch, luden sie zu einem separaten Treffen ein und brachten die Ergebnisse in der Diskussion auf unserer Landeskonferenz in Nordrhein-Westfalen ein.
In der Gruppe Köln (und Umgebung) gibt es 130 Mitglieder im Alter von 23 bis 95 Jahren. Der Altersdurchschnitt beträgt 61 Jahre. Ein Viertel der Mitglieder (33) sind Frauen. In den letzten drei Jahren sind 15 Menschen neu in die DFG-VK eingetreten und leider drei davon wieder ausgetreten. Die in den drei Jahren davor von 2015 bis 2017 eingetretenen 16 Personen sind weiterhin Mitglieder, bei zweien fehlt uns allerdings eine aktuelle Anschrift. An den monatlichen Gruppentreffen nehmen ca. 6 bis 12 Personen teil.
Die neuen Mitglieder der letzten drei Jahre wurden im September kurzfristig zu einem Extratreffen eingeladen und gebeten, Antworten auf sieben Fragen zu geben. Einer antwortete per E-Mail, vier teilten ihre Antworten bei dem Extratreffen in einer sehr angenehmen, offenen Atmosphäre mit. Die fünf teilnehmenden Männer im Alter von 28, 32, 46, 50 und 68 Jahren stimmten anschließend zu, dass die Ergebnisse ohne Namensnennung veröffentlicht werden dürfen.
Die Antworten sind hier jeweils teilweise wörtlich oder als Gesprächsnotizen zusammengestellt:
1) Wie, wodurch, wobei bin ich auf die DFG-VK aufmerksam geworden?
• Bei einer Kunstveranstaltung in Köln auf dem Heumarkt (Straßentheater einer Gruppe aus dem Ruhrgebiet) zum Thema Drohnenmorde wurden von einem DFG-VK-Mitglied Flyer verteilt. • Kontakte mit DFG-VK-Mitgliedern in der AG Frieden und Internationale Politik (FIP) der Linken mit Einladung zur Friedensfahrradtour NRW. • Einladung zum U35-Treffen. • Zuerst früher als Mitarbeiter beim Bundesamt für Zivildienst (damals aber nicht Mitglied geworden), in der letzten Zeit Kontakte mit DFG-VK-Mitgliedern in der AG FIP mit Einladung zur Mitarbeit im Bündnis „Abrüsten statt Aufrüsten“. • Über mein Lehramtsstudium auf das Friedensthema gestoßen und dann online nach Friedensgruppen gesucht.
2) Woran erinnere ich mich bei den ersten Begegnungen?
• Interesse der DFG-VK-Gruppe an meinem Bericht von der Druschba-(Friedens)-Fahrt nach Russland. • Geselliges Beisammensein der AG FIP mit den Friedensradlern im Naturfreundehaus mit interessanten individuellen Gesprächen und dass die FFT am Abend kurz in der „Aktuellen Stunde“ im Fernsehen gezeigt wurde. • Offene Diskussion über gegensätzliche Einschätzungen z.B. zu Kilez More, Stopp-Ramstein-Aktionen oder Daniele Ganser. • Gemeinsame Vorbereitung einer Kundgebung des Kölner FF zu „Abrüsten statt Aufrüsten“. • Es gab eine anregende vielseitige Gruppen-Diskussion, in der Beiträge jeder Qualität (persönliches Kurzurteil/differenzierte Auseinandersetzung) ihren Platz hatten. Bei Würdigung aller Beiträge wurde die Entscheidung zu einer Stellungnahme mit anschlussfähiger Argumentation (Verweise auf Völkerrecht und andere internationale Verträge) getroffen.
3) Was war wichtig für die Entscheidung, Gruppenmitglied zu werden?
• Neugier und „Frieden“ im Namen der DFG-VK. • Die grundsätzliche Entscheidung für Frieden und gegen Krieg. • Die Gruppenerfahrung bei der Friedensfahrradtour in der aktuellen politischen Situation mit der Feindbildpropaganda in den Medien und dass der Mitgliedsbeitrag nicht so hoch ist (auch noch Mitglied in anderen Vereinen). • Als ich regelmäßig spenden wollte, wurde mir als Alternative die Mitgliedschaft vorgeschlagen. • Neben Information und Diskussion lebt die Gruppe von ihrer Aktivität und Einsatzbereitschaft. Die Mitglieder sind bereit, Aufgaben zu übernehmen und in Aktion zu treten. Das fand ich anregend, selbst am Ball zu bleiben.
4) Was waren meine ersten Aktivitäten mit der DFG-VK?
• Mithilfe bei einem Infostand bei einer Kundgebung zu „Abrüsten statt Aufrüsten“. • Teilnahme an der FFT. • Das U35-Treffen mit Aktionen in Kassel. • Bündnisarbeit im Kölner FF zu „Abrüsten statt Aufrüsten“. • Multiplikatoren-Schulung zu „Sicherheit neu denken“ • Schweigedemo vor der Antoniterkirche zu „Atomwaffen abschaffen“.
5) Was hat mir besonders gut gefallen?
• Bunte Mischung von Menschen mit sehr viel Engagement. • Vielfältigkeit und Menschen, die sich trauen, in der Öffentlichkeit Aktionen zu machen. • Form der Auseinandersetzungen und die vorhandenen Erfahrungen. • Kompetenz von Menschen, die etwas zum Frieden sagen können. • Die Gruppentreffen.
6) Was war beim Zusammensein mit uns unangenehm?
• Dissens beim ersten Treffen (über Abgrenzung nach rechts). • Umgang mit der Corona-Krise: „Ich mag keine Leitplanken für mein Denken.“ • Noch nix. • Noch nix, weil ich nach dem Positiven schaue. • Die Erfahrung, dass es schwierig ist, in der Breite für den Frieden zusammenzuarbeiten; oft sind wir auch bei öffentlichen Veranstaltungen nur „unter uns“. Zusätzlich spalten wir uns noch weiter auf, wenn es um Abgrenzung zu unterschiedlichen politischen Lagern geht. • Die Corona-Debatte im E-Mail-Verteiler. Sicher ist es eine Thematik, die manche Menschen aus der Gruppe stark bewegt und die z.T. mit ernstzunehmenden persönlichen Hintergründen vorgebracht wird. Peinlich wird es für mich persönlich, wenn von Grundgesetzverstößen gesprochen wird, die keine sind. Ich bekenne mich dagegen zu den Regelungen des demokratischen Diskurses unter Achtung von Gerichtsurteilen und Wahrung der Verfassung. Die Argumentation mit Grundrechten, Gesetzen und Verträgen für den Frieden und gegen Atomwaffen ist gerechtfertigt. Eine ungerechtfertigter Aufschrei, dass mit der Verordnung zum Maskentragen gegen solche Rechte verstoßen würde, schwächt die Friedensargumentation.
7) Was möchte ich uns für die Zukunft vorschlagen?
• Hier lieber Zurückhaltung, weil es leicht zu Verbindlichkeiten führt, aber weiterhin Treffen bei Demos. • Erst mal abwarten. • Ggf. Flyer verteilen. • Mehr solcher Treffen für die Neuen. • Herausforderungen annehmen, zusammen (auch mit anderen) an einem Thema zu Arbeiten (z. B. in Kampagnen). • Herausforderungen zur Neuorientierung aus der Corona-Krise aufgreifen und über weitere Manipulationen nachdenken und sprechen. Das Thema Manipulation der Meinung muss unbedingt bearbeitet werden. • Ihr macht viel richtig • Vielleicht: In Kontakt bleiben, nehme ich mir zumindest vor!
Bei jedem der fünf Teilnehmer führte nicht ein einzelner, sondern immer mehrere Anlässe/Erlebnisse/Faktoren zu der Mitgliedschaft, und von allen wurden mehrere persönliche Kontakte zu DFG-VK-Gruppenmitgliedern genannt. Nur z. T. besteht das Interesse, möglichst regelmäßig an einem Gruppentreffen teilzunehmen.
Michael Sünner aktiv in der DFG-VK-Gruppe Köln und vertritt den Landesverband NRW im Bundesausschuss.
Die Kolumne von Michael Schulze von Glaßer

Das war leider nur eine kurze Entspannung. Nun ist wieder Lockdown – und Herbst. Seit einem Jahr fand kein physisches Bundesausschuss-Treffen mehr statt: Das im März diesen Jahres ist ganz ausgefallen, die weiteren wurden virtuell abgehalten. Das funktioniert gut, ersetzt „richtige“ Treffen aber nicht: Entweder schaut man in die Kamera oder auf den Bildschirm – richtig in die Augen sehen kann man sich nicht. Es fehlt viel Zwischenmenschliches und vor allem die persönlichen Gespräche rund um die Treffen – in den Pausen und vor allem beim netten Beisammensein an den Abenden nach der Sitzung wurden schon viele gute Ideen geboren und Pläne geschmiedet. Auch der Bundessprecher*innenkreis konnte sich seit seiner Wahl nicht physisch treffen – vor allem für unseren neuen (jungen) Sprecher*innen macht das den Einstieg in die Arbeit nicht leichter. Und natürlich sind wir auch in unseren Ortsgruppen betroffen – bei meiner Gruppe In Kassel haben wir uns in den letzten Monaten bei gutem Wetter draußen getroffen, nun geht es wohl wie im Frühjahr zurück zu Online-Konferenzen. Die Pandemie und die – nach dem zwischenzeitlichen Hoch – wieder geringeren Aktivitäten (auch aufgrund der dunkleren Jahreszeit) führen auch zu weniger Aufmerksamkeit für uns und unsere Themen, was wiederum zu weniger Neueintritten führt. Zwar haben wir weiterhin einen Mitgliederzuwachs, dieser wird am Ende des Jahres aber wohl weitaus geringer ausfallen als in den Vorjahren. Die Krise hat viele negative Auswirkungen auf unsere Arbeit.
Das Ausweichen ins Digitale funktioniert bei unserer politischen Arbeit nach außen nämlich kaum. Unsere Livestreams und das Talk-Format „Conversation outta Quarantine“ auf Youtube kamen – geht man nach den Aufrufzahlen – nur mäßig an. Online ist die gesamte deutsche – wie übrigens auch die internationale – Friedensbewegung dramatisch schlecht aufgestellt. Wir sind eine Bewegung der Straße. Auch wenn die Followerzahlen unserer Socialmedia-Auftritte stetig steigen, sind sie relativ gering: Facebook 7726, Instagram 978, Twitter 678, Youtube 428. Im Gegensatz zu jungen Bewegungen wie etwa der gegen den Klimawandel (allein „Ende Gelände“ kommt auf knapp 60000 Follower*innen bei Instagram) gehört die Friedensbewegung nicht zu den „digital natives“ und tut sich digital schwer. Die Gründe dafür für die geringe Präsenz im Internet sind aber sicher vielfältig. Gerade plane ich eine Reihe von (Online-)Seminaren zur Nutzung von Social Media durch DFG-VK-Gliederungen. Wir müssen jetzt unser Bestes geben, um die Menschen auch in der Pandemie – im Lockdown – zu erreichen, vor allem aber auf ein baldiges Ende der Pandemie und einen Schutz vor Corona hoffen, um unsere Stärken wieder ausspielen zu können. Wir sollten daher unbedingt Aktionsplanungen für 2021 machen (und Hygienekonzepte mit einplanen)!
Nach der 50. Ratifizierung im Oktober, tritt der UN-Atomwaffenverbotsvertrag am 21./22. Januar 2021 in Kraft – der Druck auf die Bundesregierung, den Vertrag endlich zu unterzeichnen und die US-Atombomben aus dem rheinland-pfälzischen Büchel abziehen zu lassen, war wohl nie größer. Mit Aktionen im ganzen Land könnten wir den Druck noch erhöhen! Im April stehen wieder die Ostermärsche an, und der „Tag der Bundeswehr“ ist bereits auf den 12. Juni 2021 terminiert und soll in 16 Städten stattfinden (weitere Infos dazu gibt es auf unserer Aktionswebsite www.kein-tag-der-bundeswehr.de). So hart uns alle die Pandemie trifft, so kann sie politisch für unsere Ziele auch zum Guten sein: Angesichts der großen Menschheitsprobleme – der Pandemie, aber auch dem Klimawandel – stößt die aktuelle militärische Aufrüstung bei immer mehr Menschen auf Unverständnis. Das sollten wir auch angesichts des Wahljahres 2021 nutzen!
In dieser Kolumne berichtet Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der DFG-VK, regelmäßig, was in der DFG-VK-Geschäftsführung gearbeitet wird, welche Themen im Fokus sind, welche Materialien erstellt werden etc.
Kontakt: svg@dfg-vk.de
Bundesweites U35-Treffen der DFG-VK am Wannsee in Berlin
Ausgabe 5/2020
Von der Antimilitaristischen Aktion Berlin in der DFG-VK (amab)
Anfang Oktober fand das Wochenende der jüngeren Verbandsmitglieder in Berlin statt. In der Rückschau zwei wichtige Erkenntnisse: Es gibt für antimilitaristische Themen viele aktive, jüngere Bündnispartner*innen außerhalb der DFG-VK, und die Liste von Aufgaben für die Zukunft des Verbandes ist lang.
Vom 2. bis 4. Oktober fand nach zwei Jahren wieder ein bundesweites Treffen des U35-Netzwerkes statt. In die Organisation waren vor allem unser politischer Geschäftsführer Michi, wir von der amab und die Mitglieder der Military Busters aus Hildesheim eingebunden. Weil wir glauben, dass pazifistische und antimilitaristische Themen sehr wohl junge Menschen interessieren, haben wir das Wochenende diesmal auch explizit außerhalb des Verbandes beworben. Und so trafen wir uns im Jugendgästehaus am Wannsee mit ungefähr 35 Teilnehmenden aus Berlin, Kassel, Köln, Frankfurt (O. + M.), Marburg, Flensburg, dem Wendland, Freiburg, Stuttgart, Dresden, Leipzig und Hildesheim.
Das Wochenende lief unter der methodischen Ausrichtung des Voneinander-lernens. Die angereisten Teilnehmenden organisierten das Programm größtenteils selbst. Der Schwerpunkt lag dabei auf kreativen Interventionen im öffentlichen Raum.
Mit Eugen Januschkes Vortrag über militaristischen, teils steingewordenen Heldenkult, die Kontinuität der zweifelhaften „Traditionspflege“ der Bundeswehr und der Diskussion darüber, wie man mit „gefallenen“ Soldat*innen umgehen könne, steuerte auch der Landesverband Berlin eine Veranstaltung bei. Die aus Hildesheim angereiste Gruppe berichtete von ihren praktischen Erfahrungen mit Re-Kontextualisierung mittels Sprechblasen und Spraydose an Kriegsdenkmälern. In einem Praxisteil waren die Teilnehmenden dann dazu aufgerufen, auf Fotos von unangetasteten Denkmälern selbst kreativ zu werden.
Da Politik bekanntermaßen Geld kostet, fand auch die Runde mit dem Titel „Wie finanziere ich meine politische Arbeit und wie machen das andere?“ regen Zulauf. In rund zwei Stunden wogen die Teilis verschiedene Finanzierungsmodelle ab. Dabei berichtete Kathi Müller beispielsweise von ihren Erfahrungen bei der Finanzierung des UN-Besuchs.
Die geplante Pause am Samstagnachmittag wurde spontan gestrichen und durch eine Reflexionseinheit zu genderspezifischer Diskriminierung ersetzt. Die Teilnehmenden trafen sich in zwei Gruppen: Einerseits die strukturell-konkret eher Diskriminierenden also cis-Männer. Andererseits Teilnehmende mit genderspezifischer Diskriminierungserfahrung aka Frauen*-Lesben-Trans-Intergeschlechtliche Teilnehmende, auch als FLINT* bezeichnet. [Anm. d. Red.: aka ist die Abkürzung des englischen „also known as“ = „auch bekannt als“]
Bei der Runde von männlich gelesenen Teilnehmenden herrschte keineswegs Einhelligkeit. Während sich die Mehrheit selbstkritisch über eigene Fehler öffnete, negierten andere die Existenz geschlechtsspezifischer Zurückweisung und der eigenen Verstrickungen darin. In der FLINT*-Gruppe ergab der Austausch viele Dimensionen von Diskriminierungserfahrungen durch Typen: dominantes Redeverhalten; FLINT*-Personen nix zutrauen; auf Objekte zum Baggern reduziert werden. Jenseits dieser Einheit dominierten übrigens männlich gelesene Teilnehmende die Workshop-Leitungen und die Organisation des Wochenendes. Das alles zeigt, dass das Thema Gender und Militär keineswegs nur nach außen verhandelt gehört, sondern ebenso als Metaebene unseren eigenen politischen Alltag begleiten muss. Denn in die Zukunft des Verbands wies das Gender-Verhältnis am Wochenende: Eine Mehrheit der Teilnehmenden war nicht männlich.
Für Kontroversen sorgte auch die Diskussion darüber, wie die Zukunft des Verbands gestaltet werden solle. Bereits eine Auswahl der Antworten auf die Frage nach Themen, die bisher im friedenspolitischen Kontext zu kurz kämen, liest sich wie eine einzige Mängelanzeige: Rassismus, Flucht und Migration, Klimakrise, Antisemitismus, Diskussionskultur, Datensicherheit. Die Handlungsmöglichkeiten zur Veränderung erinnern streckenweise an die To-do-Liste von Sisyphos höchstpersönlich: Webinare für niedrigschwelligen Zugang, visuelle Kampagnenarbeit diversifizieren, lokale Kooperation zu Inis mit den jeweiligen politischen Schwerpunkten, mehr in englischer und anderen Sprachen anbieten u.a. Es wurde aber auch wertschätzend betont, dass einige Ideen bereits in verschiedenen Kontexten des Verbands angegangen werden und das auch nicht nur von jüngeren Mitgliedern.
Zumindest wir von der amab glauben, dass die U35-Vernetzungstreffen sinnvolle Werkzeuge für die Vernetzung junger Pazifist*innen und Antimilitarist*innen in und mit der DFG-VK sind. Das zeigt auch das Anmeldungsverfahren: Nach nicht mal zwei Wochen waren alle Plätze vergeben. Ohne Pandemie hätte die Veranstaltung leicht doppelt so groß werden können; das umfangreiche Hygienekonzept in Abstimmung mit dem Haus und den Verordnungen begrenzte verständlicherweise die Platzzahl. Wir freuen uns auf eine Neuauflage!