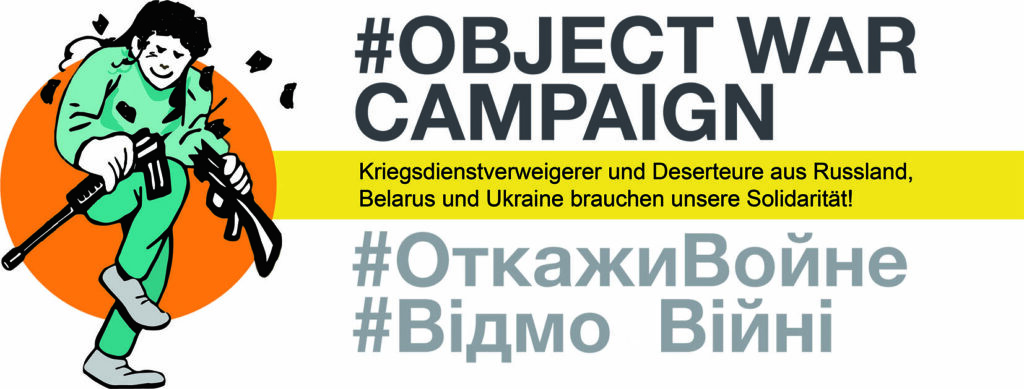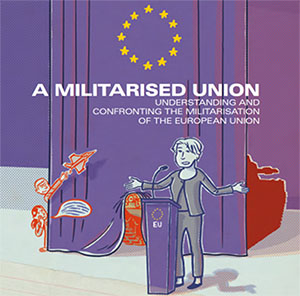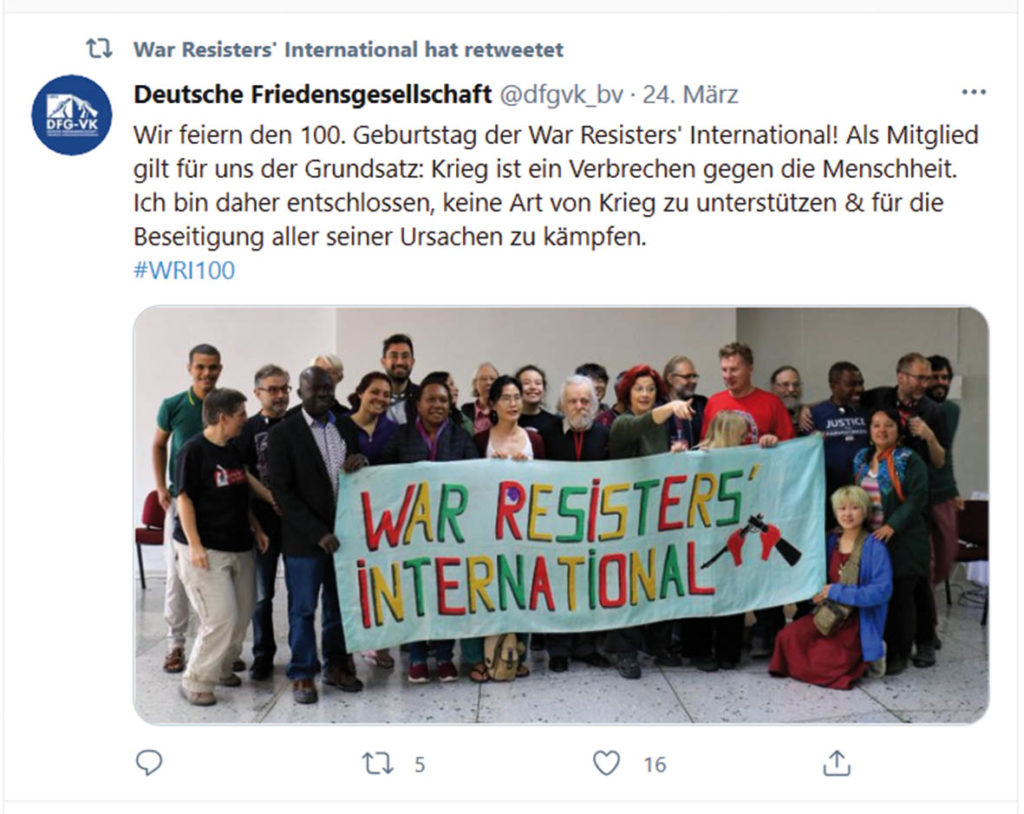| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2022 |
International
Gefangenenliste der War Resisters´International zum 1. Dezember
Von Gernot Lennert

Solidarität mit den Gefangenen für den Frieden: Zum Internationalen Tag der Gefangenen für den Frieden am 1. Dezember bittet die WRI um Solidarität mit Menschen, die weltweit wegen ihrer KDV oder ihres Engagements für Frieden inhaftiert sind. Ihre Namen und Gefängnisadressen werden in der Liste der Gefangenen für den Frieden veröffentlicht.
Die WRI ruft dazu auf, den Gefangenen Kartengrüße als Zeichen der Solidarität und der Ermutigung in die Haft zu schicken. Selbst wenn die Karten die Gefangenen nicht erreichen sollten, machen sie deutlich, dass diese nicht vergessen sind, was sich auf die Haftbedingungen günstig auswirken kann.
Die Liste enthält die Adressen von Gefangenen stellvertretend für viele andere, deren Adresse unbekannt ist oder die keine Publizität wünschen.
In Ländern wie Süd-Korea, Singapur, Turkmenistan und Tadschikistan waren in den letzten Jahren ständig KDVer im Gefängnis, die meisten von ihnen Zeugen Jehovas. Besonders katastrophal ist die Menschenrechtslage in Eritrea. Dort werden Männer und Frauen zu einem zeitlich unbegrenzten Nationaldienst gezwungen, teils Militär-, teils Arbeitsdienst unter härtesten Bedingungen. In Kamerun werden Menschen, die sich gewaltfrei für Menschenrechte und Autonomierechte des englischsprachigen Landesteils einsetzen, inhaftiert.
Die nächste Liste der Gefangenen für den Frieden wird zum 1. Dezember veröffentlicht werden: www.wri-irg.org
Veranstaltungen zum Tag der Gefangenen für den Frieden
Berlin: 30. November, 19 Uhr, Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4. Mit Franz Nadler (Connection e.V.): „Sand im Getriebe“ des Krieges. Widerstand gegen die Rekrutierung für den Ukraine-Krieg und Solidaritätsarbeit für KDVer und Deserteure aus Russland, Belarus und der Ukraine; Wolfram Beyer (IDK): Antimilitaristische Arbeit unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges; Gernot Lennert (DFG-VK Hessen): Reaktivierung von Kriegs- und Zwangsdiensten. www.idk-info.net
Offenburg: 4. Dezember, 16 Uhr, Uhlandstraße 5. Jährliches Treffen zum Schreiben der Grußkarten an die Gefangenen für den Frieden – als gemütliches Treffen mit Kaffee, Tee und Friedensmusik. Anmeldung bitte bis zum 2. Dezember bei der DFG-VK Mittelbaden: mittelbaden@dfg-vk.de
Zornheim bei Mainz: 9. Dezember, 19 Uhr. HerrBerts Kulturscheune, Untergasse 10. Die DFG-VK lädt ein zum gemeinsamen Schreiben der Karten an die Gefangenen für den Frieden mit Live-Musik von Strohfeuer Express, Bilder-Schau, Speis´ und Trank. www.dfg-vk-mainz.de
Die Karten an die Gefangenen können sowohl gemeinsam und öffentlich als auch privat geschrieben werden
Gernot Lennert (DFG-VK Hessen)