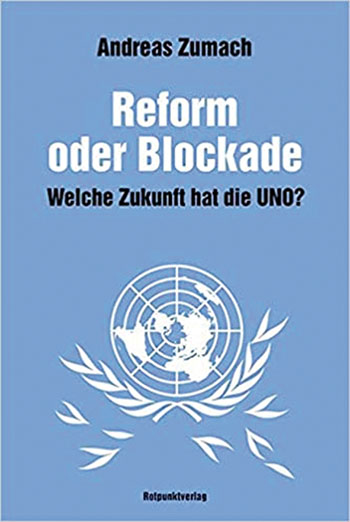| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2022 |
Friedensarbeit
Der Göttinger Friedenspreis – ein Kollateralschaden des Ukrainekrieges
Von Andreas Zumach

Am 10. September sollte das deutsch-russische Projekt „Musik für den Frieden“ in einer öffentlichen Feier mit der Verleihung des Göttinger Friedenspreis (GFP) ausgezeichnet werden. Das ursprünglich am Musiktheater in Grenzach-Whylen von den Müllheimer MusikpädagogInnen Ulrike und Thomas Vogt gegründete Ensemble MIR (russisch: Frieden) kooperiert seit 2018 mit dem Jugendtheater „Premier“ aus der zentralrussischen Stadt Twer. Die gemeinsamen, zunächst via Internet einstudierten Projekte „Musik für den Frieden“ wurden vor der Coronapandemie in Russland und Deutschland als Live-Konzerte aufgeführt.
Während der Coronazeit wurden von beiden Ensembles in einer intensiven Online-Zusammenarbeit drei Musikvideos produziert und auf dem Youtube-Kanal „Musik für den Frieden“ veröffentlicht. Der zivilgesellschaftlich engagierte künstlerische Austausch der deutschen und russischen Jugendlichen soll zeigen, dass trotz der fatalen politischen Situation in Europa eine freundschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit über Grenzen hinweg möglich ist.
Doch Mitte Juni wurde die seit Anfang Januar auf der GFP-Webseite (www.goettinger-friedenspreis.de) angekündigte Verleihungsfeier von der den Preis vergebenden Stiftung ohne jede Begründung abgesagt. Was war geschehen?
Einstimmige Entscheidung für „Musik für den Frieden“. Bereits im September 2021 hatte die unabhängige GFP-Jury das Projekt „Musik für den Frieden“ unter über 30 Vorschlägen einstimmig als Preisträger für das Jahr 2022 ausgewählt. (Zu der Jury gehörten unter dem Vorsitz des Autors dieses Artikels die Friedens-und Konfliktforscherin Dr. Regine Mehl und die renommierte Atomwaffenexpertin und frühere Redakteurin der Zeitschrift „Wissenschaft & Frieden“ Regina Hagen). Die Jury traf ihre Entscheidung angesichts der Spannungen und Konflikte zwischen dem Westen und Russland, die nicht erst seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im März 2014 ständig zunehmen.
Zur Begründung ihrer Wahl schrieb sie: „Die Jury würdigt mit diesem Preis den wichtigen zivilgesellschaftlichen Beitrag dieses Projektes zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, gerade in Zeiten, in denen diese Beziehungen auf der offiziellen Ebene der Politik geprägt sind durch erhebliche Konflikte sowie zunehmendes gegenseitiges Unverständnis.“
Seit dem zwischenzeitlichen Beginn des Ukrainekrieges wurden in Deutschland törichterweise zahlreiche Beziehungen in die russische Zivilgesellschaft auf Eis gelegt oder gar ganz abgebrochen. Als Signal gegen diesen fatalen Trend wäre die öffentliche Preisverleihung an ein rein zivilgesellschaftliches deutsch-russisches Friedensprojekt umso wichtiger gewesen.
Absage ohne Begründung. Doch stattdessen hatte der Ukrainekrieg genau die gegenteilige Folge: Am 18. Juni teilte der GFP-Stiftungsvorsitzende Hans-Jörg Röhl den völlig überraschten Preisträgern die Absage der für den 10. September geplanten Feier mit. Ohne Begründung. Auch eine nachfolgende Pressemitteilung sowie die gemeinsame Erklärung von Röhl und dem Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, Götz Neuneck, auf der GFP-Webseite enthalten keine Begründungen.
Auf Nachfragen von JournalistInnen erklärte der Pressesprecher der Stiftung, Thomas Richter: „Wir geben keinen Grund an.“ (Badische Zeitung, 23.6.2022). Auch stiftungsintern waren und sind bis heute keine triftigen oder gar zwingenden Gründe für die Absage zu erfahren.
Im Mai hatte ein Göttinger Mitglied der Stiftung Ängste vor einer Durchführung der Preisverleihung noch während des Ukrainekrieges geäußert. Doch statt zunächst eine stiftungsinterne Diskussion auch unter Beteiligung der Jurymitglieder über diese Ängste zu führen, vereinbarte das für die Organisation der jährlichen Feier zur Preisverleihung zuständige Komitee der Stiftung ein Gespräch mit dem Leiter der Staatsschutzabteilung der Göttinger Polizei. Dieses Gespräch habe ergeben, „dass mit Sicherheit mit erheblichen Demonstrationen und Störversuchen von den Kriegsgegnern und Russlandbefürwortern zu rechnen ist“, schrieb die Vorsitzende des Organisationskomitees, Carmen Barann, in ihrem Bericht an die Stiftungsmitglieder. Doch diese Formulierung ist eine aufbauschende Verfälschung.
Tatsächlich hatte der Leiter des Staatsschutzes lediglich gesagt, es „könnte möglicherweise zu Störaktionen, Demonstrationen und sonstigen Missfallenskundgebungen kommen“. Für diese Einschätzung konnte der Leiter des Staatsschutzes in dem Gespräch allerdings keinen einzigen konkreten Anhaltspunkt nennen.
Dieser wesentliche Umstand wurde in dem Bericht des Organisationskomitees an die Stiftungsmitglieder ebenso verschwiegen wie die Tatsache, dass der Staatsschutzleiter in dem Gespräch ausdrücklich „versicherte, dass die Polizei in jedem Fall einen störungsfreien Ablauf der Preisverleihung gewährleisten würde“. Zusätzlich angeheizt wurde die Hysterie durch die Behauptung des GFP-Pressesprechers Thomas Richter, bei Durchführung der geplanten öffentlichen Feier seien „harsche Reaktionen der Regionalpresse zu erwarten“. Eine Lektüre sämtlicher Berichte und Kommentare der beiden Regionalzeitungen „Göttinger Tageblatt“ und „Hessisch Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) zum Ukrainekrieg seit dem 24. Februar ergab jedoch keinerlei Anhaltspunkte für diese Erwartung.
Einzig auf Basis dieser Erwartung sowie des irreführenden und unvollständigen Berichts des Organisationskomitees traf der Präsident der Universität, Professor Dr. Metin Tolan, (qua seiner Funktion Mitglied des Stiftungskuratoriums) die Entscheidung, die Aula der Universität, in der die Preisverleihung seit 1999 traditionell stattgefunden hatte, wegen „Sicherheitsbedenken“ nicht zur Verfügung zu stellen. Diesselbe Entscheidung traf das Stiftungsmitglied Erich Sidler, Intendant des Deutschen Theaters (hier hatte die Veranstaltung 2021 stattgefunden). Und Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (ebenfalls qua Funktion Mitglied des Stiftungskuratoriums, da die Stadt traditionell nach der jährlichen Verleihungsfeier zu einem Empfang im historischen Rathaus der Stadt einlädt) riet von der Durchführung der Feier „in diesem Jahr“ ab. Dieser Empfehlung schloss sich das Organisationskomitee der Stiftung an.
Auf ausdrückliche Nachfrage an Uni-Präsident Tolan, Theaterintendant Sidler und Oberbürgermeisterin Broistedt, ob es neben dem irreführenden und unvollständigen Bericht über das Gespräch mit dem Leiter des Staatsschutz sowie der völlig unbegründeten Vorverurteilung der Regionalmedien durch Pressesprecher Richter irgendeinen weiteren Anlass oder Grund für ihre Entscheidungen und Empfehlung gegen die Durchführung der Feier gab, erhielt der Autor dieser Zeilen keine Antwort.
Mit diesen Vorentscheidungen war die Absage der Veranstaltung besiegelt. An dem gesamten stiftungsinternen Prozess der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung wurden die Mitglieder der Jury nicht beteiligt. Neunmal zwischen Anfang und Mitte Juni baten sie vergeblich um die Erläuterung der vorgebrachten „Sicherheitsbedenken“. Sämtliche Fragen der Jury wurden nicht beantwortet. Aus diesem Grund, und weil sie die Absage für einen großen Fehler halten, erklärten die Jurymitglieder am 19. Juni ihren Rücktritt.
Sie kritisierten die Absageentscheidung als „ein Signal von mangelnder Zivilcourage, beschämender Feigheit und vorauseilendem Gehorsam vor einer ganz offensichtlich imaginären Bedrohung.“ Diese Entscheidung spiele „der derzeitigen massiven Feindpropanda der Regierung Putin und der staatlich gelenkten russischen Medien gegen den Westen in die Hände.“
Um die große Enttäuschung insbesondere der an dem Friedensprojekt beteiligten russischen und deutschen Jugendlichen über die Absage zumindest zu begrenzen, schlug die Jury vor, den Preis im Rahmen eines ohnehin für den 11. September geplanten Konzertes in der Berliner Gedächtniskirche zu übergeben. So wurde verfahren.
Auf der Webseite der GFP verbreiten die Vorsitzenden der Stiftung und ihres Kuratoriums, Röhl und Neuneck, inzwischen die nachweisliche Falschbehautpung, es habe „ein demokratisches Abstimmungsverfahren“ gegeben, bei dem „alle Mitglieder der Stiftung über die gleichen Informationen verfügt“ hätten. Der Jury wird vorgeworfen, sie habe diese angeblich demokratische Mehrheitsentscheidung „nicht akzeptiert“ und damit gegen einen „demokratischen Grundsatz“ verstoßen. Eine Begründung für die Absage der Feier liefern Röhl und Neuneck weiterhin nicht. Die Erklärung vom 19. Juni, in der die Jury ihre Haltung und ihren Rücktritt ausführlich begründet, wird auf der GFP-Webseite unterschlagen.
In Folge dieser stiftungsinternen Kontroverse hat Uni-Präsident Tolan seinen Sitz im Kuratorium der Stiftung inzwischen aufgegeben und damit die seit 1999 bestehende Kooperation zwischen der Göttinger Universität und der Stiftung beendet. Die historische Aula der Uni steht damit als Ort für künftige Verleihfeiern nicht mehr zur Verfügung. Auch Pressesprecher Richter hat seine Mitgliedschaft in der Stiftung und seine dortige Funktion als Beirat für Öffentlichkeitsarbeit aufgegeben.
Andreas Zumach, DFG-VK-Mitglied und freier Journalist in Berlin, ist Träger des Göttinger Friedenspreises 2009 und gehörte seit 2012 der Jury an, seit 2018 als ihr Vorsitzender.