 | Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2021 |
Literatur
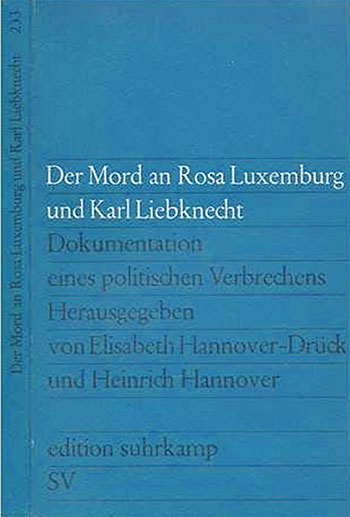
Was uns „alte“ Bücher heute sagen können
Wer kennt das nicht? Man zieht um, mistet aus, sucht etwas im Bücherregal. Und stößt auf ein altes Buch, von dem man denkt: Das war damals eine wichtige Lektüre, das wollte ich unbedingt noch einmal lesen. Und es könnte auch für andere bereichernd sein. Oder aus einem aktuellen Anlass gelesen werden sollen.
Wer selbst solche alten Schätze wieder entdeckt, der kann sie hier in dieser Rubrik präsentieren.
Werner Glenewinkel präsentiert im Teil 2 unserer Reihe:
Elisabeth Hannover-Drück und Heinrich Hannover (Hrsg.): Der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Dokumentation eines politischen Verbrechens. Frankfurt am Main 1967
Dieses Buch war damals, 1967, eine wichtige Lektüre und soll heute zum Wiederlesen vorgestellt werden. Denn in diesem Jahr wären Rosa(lie) Luxemburg und Karl Liebknecht beide 150 Jahre alt geworden. Geboren im Jahr der Gründung des Deutschen Reiches, die ja ausführlich in den Medien besprochen wurde, hat ihr Geburtstag wenig mediale Aufmerksamkeit gefunden. Das Theater in Meran hat aus diesem Anlass ein beeindruckendes Theatermemorandum in drei Bildern aufgeführt: „Rosa Luxemburg. Ich war. Ich bin. Ich werde sein.“ Das ist auch der Titel einer ihrer Aufsätze, und in ihm findet sich dieser Satz: „Mensch sein ist von allem die Hauptsache. Und das heißt fest und klar und heiter sein, ja heiter, trotz alledem.“ Auch dieses Theatermemorandum endet in der Nacht zum 15. Januar, in der Rosa Luxemburg und ihr Genosse Karl Liebknecht verschleppt, gefoltert und ermordet wurden.
Die Herausgeber Elisabeth und Heinrich Hannover, woll(t)en mit diesem Buch keinen Kriminalfall (der es auch ist) aufklären. „Die Täter interessieren sie nicht als Personen, sondern nur als typische Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und der von ihnen beherrschten staatlichen Institutionen“, heißt es im Vorwort. Liebknecht und Luxemburg seien nicht gefährlich gewesen, „weil sie über physische Gewalt verfügt hätten, sondern weil sie im Begriff standen, die deutsche Arbeiterschaft über ihre Klasseninteressen aufzuklären (…)“. „Gegen Aufklärung“, heißt es dann weiter, „hat eine Herrschaftsordnung, die weder moralisch noch vernunftmäßig zu rechtfertigen ist, nur ein Mittel: die Gewalt.“ (Seite 7) Denn die Vertuschung des Mordes begann bereits in der Mordnacht, weil „ein wesentlicher Teil der jungen Weimarer Republik in die Hände eines in reaktionärem Geiste geführten Militärs gelegt wurde (…)“. Und „weil die Justiz der Republik ebenfalls in den Händen von Angehörigen ihrer Gesellschaftsschicht lag“ (S. 8). Denn die beiden Arbeiterführer erlebten seit Langem einen ungeheuren Kollektivhass, der von einer gelenkten Hasspropaganda gegen Minderheiten verstärkt wurde. „Die Erzeugung von Progromstimmung“, schreiben die Herausgeber weiter, „gegen aufklärerische Minderheiten – Sozialisten, jüdische Intelligenz, ,Linksintellektuelle‘, Studenten – ist eines der Mittel, mit denen sich die herrschende Klasse die Assistenz der brutalen Dummheit sichert.“ (S. 9)
Mit Hilfe der noch einsehbaren Verfahrensakten sowie zahlreicher Presseberichte stellen die Herausgeber „ein historisches Ereignis als Teil eines dialektischen gesellschaftlichen Prozesses dar“ (S. 10). Nach der Darstellung der politischen Vorgeschichte des Mordes wird die politische Rolle von Luxemburg und Liebknecht kurz skizziert. Ein Satz der bis heute mit Rosa Luxemburg verbunden ist lautet: Die Freiheit ist immer die Freiheit der anders Denkenden. Für Karl Liebknecht ist dieser Satz wohl sehr charakteristisch: Die Furcht ist der schlechteste Ratgeber.
Dann wird der Mord im Spiegel der zeitgenössischen Presseberichte geschildert. Den Schwerpunkt bildet der Prozeß vor dem Feldkriegsgericht gegen den Husaren Runge und Genossen sowie gegen sechs zum Teil hochrangige Offiziere. Die Auszüge aus dem Verhandlungsprotokoll des Feldkriegsgerichts klingen z.T. unglaublich und gewähren tiefe Einblicke in die Strukturen der jungen Weimarer Republik. Das Urteil soll hier mit dem Kommentar aus der Frankfurter Zeitung vom 16. Mai 1919 beschrieben werden:
„Der Ausgang der vor dem Kriegsgericht wegen der Ermordung von Liebknecht und Rosa Luxemburg geführten Verhandlungen ist aus rechtlichen wie aus politischen Gründen durchaus unbefriedigend. Denn zwei schwere Mordtaten bleiben ungesühnt, da die über einige Angeklagte verhängten Strafen nicht das Hauptverbrechen, den Mord selbst, sondern nur die Begleitumstände betreffen. Das Gericht ist im Gegensatz zu den Anträgen des Anklagevertreters für die meisten Angeklagten zu einem freisprechenden Ergebnis gelangt, weil es den Schuldbeweis nicht als geführt ansah.“ (S. 123)
Damit ist die Dokumentation aber noch nicht beendet. Es folgt der sogenannte Jorns-Prozeß. Kriegsgerichtsrat Jorns, lange Jahre bei der sog. Schutztruppe in China und Deutsch-Südwestafrika kämpfend, hatte die Anklage im Prozess gegen die Mörder von Luxemburg und Liebknecht vertreten. Am 24. März 1928 erschien in der Zeitschrift Das Tagebuch ein anonymer Aufsatz mit dem Titel Kollege Jorns. Darin wird Jorns, der inzwischen Reichsanwalt geworden war, vorgeworfen, er habe in dem Verfahren den Liebknecht-Luxem-
burg-Mördern Vorschub geleistet. Etwa ein Jahr später beginnt vor dem Schöffengericht in Berlin-Mitte die Hauptverhandlung gegen den verantwortlichen Redakteur der Zeitschrift. Josef Bornstein wurde Beleidigung und üble Nachrede vorgeworfen. Er gab den Namen des Verfassers des Artikels nicht preis. Der Prozess wurde dank der Verteidigung durch den SPD-Reichstags-Abgeordneten Dr. Paul Levi und die Vernehmung des kommunistischen Reichstags-Abgeordneten Wilhelm Pieck (dem späteren Staatspräsidenten der DDR) zu einer neuerlichen, wenn auch indirekten, Anklage gegen die freigesprochenen Offiziere. Es verstärkten sich die Indizien für eine Planmäßigkeit der Morde.
„Das Urteil des Schöffengerichts sprach den Angeklagten Bornstein am 27. April 1929 von der Anklage der Beleidigung und der üblen Nachrede frei. Es sah den Wahrheitsbeweis für die ehrenkränkenden Behauptungen des Aufsatzes in allen wesentlichen Punkten als erbracht erbracht.“ (S. 158) Die Presseberichte zeigten, schreiben die Herausgeber, „die Unterschiede der Berichterstattung und des politischen Denkens, die wir auch in der Presse unserer Tage [also in den 60er Jahren; d. Verf.] wieder finden“ (S. 158).
Die Berliner Volkszeitung schrieb dazu: „Das Gericht hat einen Spruch gefällt, der sicher dem Ansehen der deutschen Justiz außerordentlich zuträglich sein wird. Es hat in vollem Maße das Recht der Presse auf Kritik anerkannt und sich weder auf die formale Ausrede zurückgezogen, dass die Kritik in der Form gefehlt habe, noch auf die, dass in Nebenpunkten der Wahrheitsbeweis nicht erbracht sei. Wenn jetzt gesagt wird, dass der Freispruch für Bornstein eine Verurteilung für Jorns bedeutet, so ist das zutreffend. Aber man muss doch wohl noch einen Schritt weitergehen. Verurteilt worden ist in Moabit das ganze System jenes Helldunkels, das in den Januar Tagen 1919 Deutschland beschattete“ (S. 162).
Fünf Jahre später wird in Schatten der Vergangenheit ein Briefwechsel zwischen dem preußischen Justizministerium und dem preußischen Ministerpräsidenten geschildert. Am Ende steht im Juli 1934 ein Dankesbrief des damals verurteilten Otto Emil Runge. Darin spricht er seinen „besten nationalsozialistischen Dank“ für die ihm gewährte einmalige Entschädigung von 6 000 Reichs-Mark aus. Grundlage ist das Gesetz über die Versorgung der Kämpfer für die nationale Erhebung vom 27. Februar 1934.
Der Epilog von Elisabeth und Heinrich Hannover klingt bedrückend. „Denn gerade die Partei,“ schreiben sie, „die sich rühmen könnte, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht bis in den Ersten Weltkrieg hinein als Mitglieder geführt zu haben, scheint sich nicht gern an sie zu erinnern“ (S. 185). Dann beklagen sie die damals wenig ausgeprägte Erinnerungskultur: Sie erwähnen, dass das nach den Plänen des Architekten Ludwig Mies van der Rohe 1924 auf dem Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde errichtete Denkmal von den Nazis abgebrochen worden sei; dass 1941 die Gräber eingeebnet seien und im Friedhofsregister mit roter Tinte die Verfügung eingetragen worden sei, dass eine Umbettung Karl Liebknechts nicht in Frage käme. Auch zwei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der faschistischen Herr-
schaft, schreiben sie im damals, den 1960er Jahren, üblichen Sprachgebrauch, gebe es im westlichen Teil Deutschlands kaum eine Straße, die nach einem der beiden großen Sozialisten benannt sei. Wenigstens das hat sich – über 50 Jahre später – geändert. Im Internet erfährt man, dass es mittlerweile über 200 Straßen in Deutschland mit dem Namen Rosa Luxemburg und etwas 300 mit dem Namen Karl Liebknecht gibt.
Zum Schluss lohnt ein Blick auf die beiden Herausgeber: Elisabeth (1928-2009), studierte Historikerin, und Heinrich (heute 96 Jahre alt), seit 1954 als Rechtsanwalt zugelassen, waren ein produktives Paar. Die Beschäftigung mit Luxemburg und Liebknecht war kein Zufall. Bereits 1966 erschien von ihnen Politische Justiz 1918-1933 im Fischer-Verlag. Heinrich Hannover war von Anfang an in Verfahren wegen politischer Straftaten engagiert (ausführlich dazu Wikipedia zu Heinrich Hannover) und ein entschiedener Verfechter der „Herrschaft des Rechts“. Ohne sie so zu nennen hat er sehr früh auf die „Furchtbaren Juristen“ (so der Titel des Buches von Ingo Müller 1987) hingewiesen hat, die ihre im Nationalsozialismus begonnenen Karrieren ungehindert fortführen und dabei ihrer Gesinnung treu bleiben konnten. Hannover war ein Gegner der westdeutschen Wiederbewaffnung und Mitglied im Verband der Kriegsdienstverweigerer sowie einer der bekanntesten Verteidiger von Kriegsdienstverweigerern. Dass er daneben auch über 40 Jahre hin eine Fülle schöner, anregender Kinderbücher geschrieben hat, macht ihn zu einem ganz besonderen Juristen.
Werner Glenewinkel ist DFG-VK-Mitglied, promovierter Jurist und war Vorsitzender der Zentralstelle KDV.