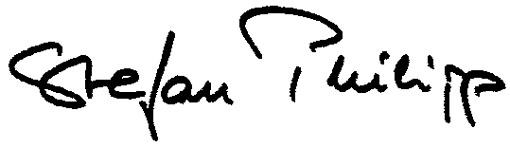| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2021 |
Titel
Erklärung des DFG-VK-Landesverbands NRW

Jetzt geht es Corona an den Kragen: Die Leitung des einzurichtenden Krisenstabes übernimmt ein Bundeswehr-General!
In der WAZ wird unter der Überschrift „Dieser General soll die Pandemie besiegen“ schon mal festgestellt, Olaf Scholz vertraue offenbar mehr der „nüchternen Analyse der Militärs als den Einschätzungen der Virologen“. Ein Armutszeugnis für das zivile Krisenmanagement unseres Staates, aber auch ein erschreckendes Bild der kommenden Regierung, die meint, Gesundheitsprobleme mit militärischem Befehl und Gehorsam lösen zu können.
Dies ist bis jetzt der Höhepunkt des schleichenden Einzugs des Militärs in die zivilen Bereiche der Gesellschaft. Schon seit Jahren wird die zivil-militärische Zusammenarbeit ausgebaut, Militärs auf kommunaler Ebene an führender Stelle in den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe integriert. All das, obwohl der Einsatz des Militärs im Inneren in Deutschland aus guten Gründen auf wenige Ausnahmefälle beschränkt ist. Offenbar gibt es immer noch genug Menschen, die den preußischen Irrglauben an die militärische Überlegenheit in allen Lebenslagen nicht abgelegt haben.
In Deutschland gilt eine strikte Trennung von militärischen (Verteidigungs- und Abwehraufgaben) und polizeilichen (Gefahren- und Verbrechenspräventionsmaßnahmen) Aufgaben . Dies ist eine Konsequenz aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. In Artikel 87a Abs. 2 Grundgesetz ist ein Verfassungsvorbehalt für einen Einsatz der Streitkräfte formuliert: „Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.“ Die Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Innern sind limitiert auf Katastrophennotstände, welche bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen auftreten können. Trotzdem wird von Seiten der Armee und bestimmten politischen Kräften immer wieder versucht, diesen engen Rahmen auszuweiten.
Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Bundeswehr ihr Image verbessern will und der Bevölkerung zeigen möchte, dass sie den Menschen hilfreich zu Seite steht. Dass die manchmal auftretende Notwendigkeit, die Bundeswehr und ihr Gerät z.B. bei Flutkatastrophen einzusetzen, ist vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass die Bundeswehr jährlich Milliarden Steuergelder verschlingt; dass die dem zivilen Katastrophenschutz fehlen, wird dabei verschwiegen.
Erklärung des DFG-VK-Landesverbands NRW vom 30.11.2021