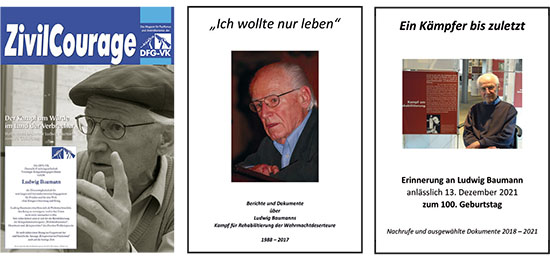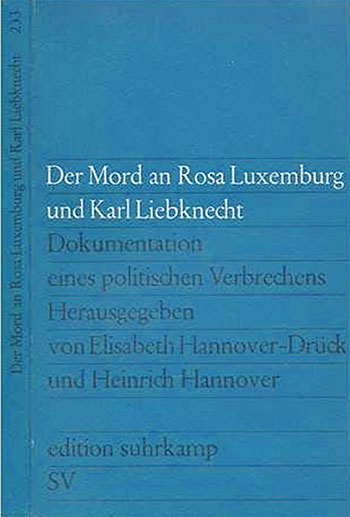| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2021 |
Erinnerung

Trauer um Tina Gewehr (22.11.1962 – 21.9.2021)
Tina Gewehr, Aktive der DFG-VK Mainz-Wiesbaden, ist tot. Ende Mai begann eine Abwärtsspirale an Erkrankungen. Kurz nach einer Krankenhausentlassung erlitt sie einen Herzstillstand. Nachdem sie körperlich stabilisiert zu sein schien, starb sie im Alter von nur 58 Jahren.
Tina ist nicht nur aus ihrem eigenen Leben gerissen worden, sondern auch aus dem Leben vieler anderer.
Tina war seit 2003 in der DFG-VK in Mainz und auch auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene aktiv.
Wir erinnern uns an so vieles:
- Eine Vielzahl von Reden bei Ostermärschen, anderen Demonstrationen und Kundgebungen;
- Radiobeiträge im nicht-kommerziellen Lokalradio Radio Quer;
- von ihr organisierte und durchgeführte Lesungen;
- Betreuung unzähliger Infostände;
- Organisation des Caterings für Friedensfahrradtouren, die Mainz besuchten;
- Mitorganisation der bundesweiten Demonstration anlässlich des Bush-Besuchs in Mainz;
- Delegierte bei allen Bundeskongressen der DFG-VK seit 2003;
- Delegierte der DFG-VK bei allen Konferenzen der War Resisters´ International seit 2006 in Deutschland, Indien, Südafrika und Kolumbien;
- Prozessbeobachterin in der Türkei;
- Autorin, Redakteurin und Korrekturleserin des Friedlichts, des Infoblatts der DFG-VK Mainz-Wiesbaden;
- Organisation unserer virtuellen Ostermärsche 2020 und 2021;
- … und vieles andere mehr.
Sie hatte noch so viele Ideen. Und wir wollten mit ihr noch so viel erleben. Leider spielte ihr Körper nicht mit.
DFG-VK Mainz-Wiesbaden