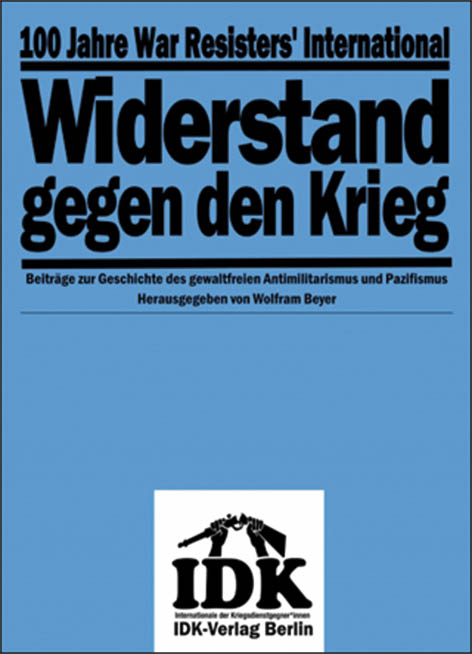| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 4/2021 |
Literatur
Was uns „alte“ Bücher heute sagen können
Von Werner Glenewinkel
Wer kennt das nicht? Man zieht um, mistet aus, sucht etwas im Bücherregal. Und stößt auf ein altes Buch, von dem man denkt: Das war damals eine wichtige Lektüre, das wollte ich unbedingt noch einmal lesen. Und es könnte auch für andere bereichernd sein. Oder aus einem aktuellen Anlass gelesen werden sollen.
Den Anfang macht von dem 1920 ermordeten Pazifisten Hans Paasche: Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins Innerste Deutschland.
1912 erstmals veröffentlicht wurde die „Forschungsreise“ seitdem in vielen Auflagen und in unterschiedlichen Verlagen immer wieder veröffentlicht. Die aktuellste Auflage ist die 2016 im Donat-Verlag erschienen.
Wer selbst solche alten Schätze wieder entdeckt, der kann sie hier in dieser Rubrik präsentieren.

Helmut Donat, Gründer und Eigentümer des Donat-Verlages in Bremen seit 1989 (www.donat-verlag.de), hat bereits als junger Mann zum einhundertsten Geburtstag von Hans Paasche 1981 im Selbstverlag „Auf der Flucht erschossen…“ – Schriften von und über den „Zivilisationskritiker“, veröffentlicht. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass er mit einer sorgfältig editierten Ausgabe 2016 einen vorläufigen Schlusspunkt hinter die bewegende Geschichte des Autors Hans Paasche und seines erfolgreichsten Buches über die Forschungsreise setzt.
In dieser Ausgabe sind zunächst die neun Briefe von Lukanga Mukara an seinen König Ruoma enthalten: Lukanga wundert sich nicht nur über das Münzgeld und das Briefeschreiben, über den Vorrang der Arbeit und die Bekleidungssitten, über Armut und Reichtum, über die Rolle der Frauen, die Mobilität, sondern auch über das Essen, das Rauchen und über die Art und Weise, den König zu feiern. Aus diesen Anlässen kann man diese grundsätzlichen Themen herauslesen: „… die ökologische Betrachtungsweise des alltäglichen Lebens, die Ursachen und Folgen ungehemmten Wirtschaftswachstums, der Verlust des Einklang mit einer natürlichen Umwelt, die Unterdrückung der Frau, die Jagd nach Geld und Profit, der Ehrgeiz und die ziellose Hektik eines falschen Lebens, das Verzweiflung und Einsamkeit, Angst und Freudlosigkeit, Krankheit und Tod gebiert“ – so Helmut Donat in seinem Beitrag zur Rezeptionsgeschichte dieses Buches (S. 117).
Im Vorwort der erstmals 1912/13 im „Vortrupp“ abgedruckten Forschungsreise schreibt der Autor, dass er auf seiner letzten Reise nach Afrika die Erkenntnis gewonnen habe, fremde Länder und ihre Menschen seien für uns ein Segen. Von ihnen könnten wir lernen, uns selbst besser zu erkennen.
Ein ungewöhnliches Ereignis habe ihm die Aufgabe, selber zur Kritik an unseren Zuständen auffordern zu sollen, abgenommen. „Ein Neger, den ich am Hofe des Königs Ruoma traf, ist meiner Anregung gefolgt und hat sich von dem Herrscher des Landes Kitara den Auftrag geben lassen, Deutschland zu bereisen“.
Lukanga Mukara von der Insel Ukara im Viktoriasee schreibt in neun Briefen an seinen Herrscher, wie er die Zustände in Deutschland zu dieser Zeit wahrnimmt, und legt dabei seinen Maßstab an. „Was uns gewohnt erscheint“, schreibt Paasche weiter, „fällt ihm auf. Seine Beobachtungsgabe und die Nacktheit seines Urteils bringen es mit sich, dass er bedeutend über Dinge sprechen kann, denen wir selbst gar nicht einmal unbefangen gegenüberstehen können.“
Damals war es noch üblich, das N-Wort wie selbstverständlich und unbefangen zu gebrauchen. Glücklicherweise hat sich der Donat-Verlag nicht veranlasst gesehen, angesichts aktueller Debatten für die jetzige Ausgabe eine Sprachkorrektur vorzunehmen.
Schließlich gibt es einen 10. Brief an den König Ruoma, in dem Lukanga – immer noch auf der Reise – von Ländern wie dem nördlichen Uganda berichtet, in denen es sehr gefährlich sei und den Kindern größtes Leid angetan werde. In Europa habe er mit Hilfe des Fernsehens viel über die Welt kennengelernt – von dem Krieg in Afghanistan, von Terroranschlägen, dem Geist des Materialismus bis hin zu Gewalt in den Familien – und könne deshalb dem König mehr davon erzählen.
Dieser Brief wurde von Kamila Jaworska 2007 verfasst.
Außerdem enthält diese Ausgabe einen Beitrag von Iring Fetscher, dem 2014 verstorbenen Politikwissenschaftler, der schon 1984 in der „Zeit“ eine Rezension zu Paasches Lukanga geschrieben hatte. Er zeichnet sorgfältig die Entwicklung des Hans Paasche (1881-1920) vom Kapitänleutnant der kaiserlichen Marine zum Pazifisten und Radikaldemokraten nach.
Hans Paasches Vater, ein führender Vertreter der Nationalliberalen Partei und viele Jahre Vizepräsident des Reichstages, zählte zu den „Stützen des Kaiserreiches, dem er diente und an dem er verdiente“ (S. 124). In diesem nie aufgelösten Vater-Sohn-Konflikt „manifestierten sich die wesentlichen Strömungen der jüngeren deutschen Geschichte: Militarismus und Pazifismus“ (S. 126).
Paasche greift mit der Form des Briefromans eine alte Tradition auf: Den „Lettres Persanes (Montesquieu 1721) und den „Cartas Marruecas“ (de Caldaso 1789). Diese Tradition hat Herbert Rosendorfer mit „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ (1986) wieder aufgenommen.
Er hat – ungewöhnlich für seine Zeit – die Schutzbehauptung der Kolonialherren, sie brächten den „Negern europäische Hochkultur“ (S. 111) als Lüge und Selbsttäuschung zurück gewiesen.
Schließlich berichtet Helmut Donat in einem interessanten Beitrag, dass das Buch während des Ersten Weltkrieges von den Militärbehörden unterdrückt wurde und erst 1921 wieder erscheinen konnte.
1929 erschien im Fackelreiter-Verlag bereits die 7. Auflage. Nach 1933 wurde „Lukanga Mukara“ wie alle anderen Schriften von Paasche verboten.
Von Paasches hundertstem Geburtstag bis zum Jahre 2009 hat das Buch immer wieder ein vielfältiges Echo in der deutschen Öffentlichkeit hervorgerufen. Es überwiegt die Einschätzung, dass uns dieses Buch auch heute noch etwas zu sagen habe: Nämlich „die vermeintliche Überlegenheit der Alten Welt gegenüber der Dritten Welt zu überdenken“ (Berliner Tagesspiegel 1984, S. 127).
Im Mai dieses Jahres hat Deutschland die Verbrechen an den Herero und Nama als Völkermord anerkannt. Der Bundespräsident hat sich entschuldigt. In den nächsten 10 Jahren sollen 1,1 Milliarden Euro in soziale Projekte investiert werden. Ein Angebot zur Versöhnung, das noch nicht angenommen worden ist.
Im Juli dieses Jahres ist das „Humboldt-Forum“ eröffnet worden. Es enthält auch ein ethnologisches Museum. Dort werden u.a. die Benin-Bronzen präsentiert werden. Über die Rückgabe an Nigeria wird demnächst verhandelt. Die Debatte um die andauernden Auswirkungen der kolonialen und imperialen Aneignung und Ausbeutung der Welt ist im vollen Gange.
In diesem Kontext erscheint es mehr als sinnvoll, sich von einem fremden Blick zu einer angemessenen Selbst-Kritik drängen zu lassen.
„… auf der Flucht erschossen“
Hans Paasche ist nur 39 Jahre alt geworden. Am 21. Mai 1920 wurde sein Gutshaus in Berlin aufgrund einer Denunziation von zwei Offizieren und ca. 50 Soldaten nach Waffen durchsucht. Paasche kam vom Baden im nahe gelegenen See und wurde „auf der Flucht erschossen“. Ein Strafverfahren gegen die Beteiligten wurde nicht eröffnet (S. 105).
Werner Glenewinkel ist langjähriges DFG-VK-Mitglied. Vor einigen Monaten veröffentlichte er das Buch „Enkel sind das Dessert des Lebens“. Eine kurze Besprechung findet sich auf der nächsten Seite.